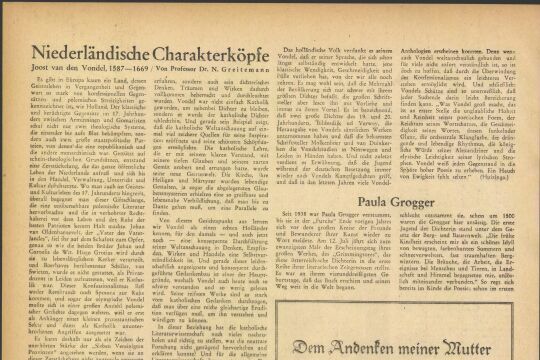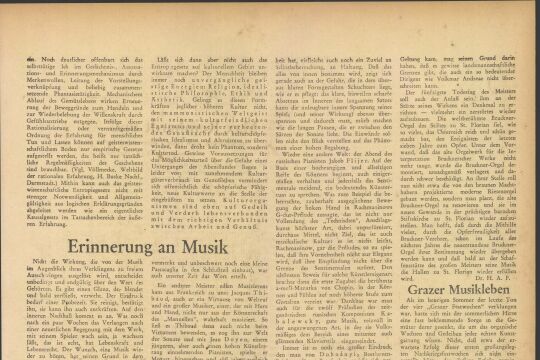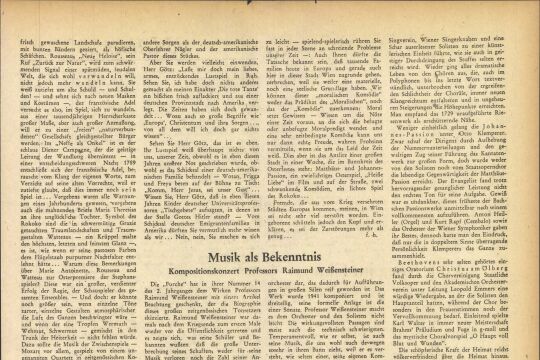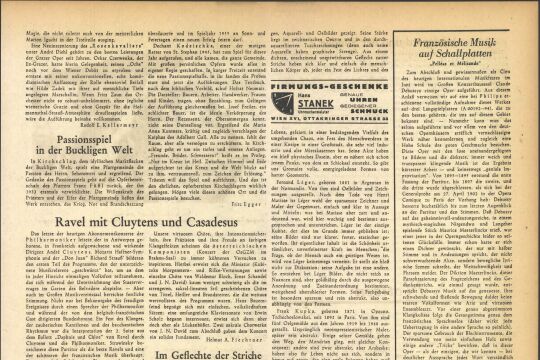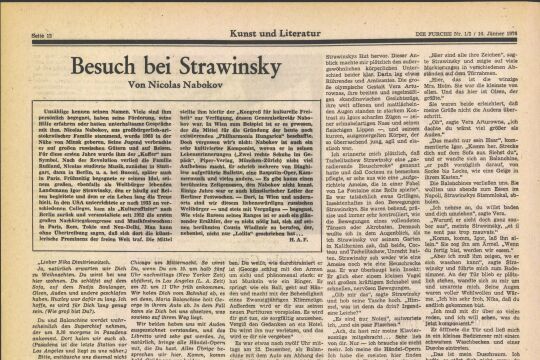Maurice Ravels Erscheinung ist wohlbekannt: seine kleine Gestalt, sein mageres Gesicht, immer tadellos rasiert, das eigenwillige Kinn, die Adlernase, die eigenartigen Augen, die zugleich durchdringend blickten und doch wie in einem bewußten Traum verloren waren. Man kennt sein asketisches Profil, das der unheilbare Schmerz in den letzten Jahren seines Lebens noch eindrucksvoller gestaltet hatte, und die todesnahe Abgezehrtheit der letzten Tage. Ein anderer, ein zweiter Ravel hat jedoch existiert, der Ravel der Jugend, der Ravel um die Jahrhundertwende, welcher mit dichtem, sorgfältig frisiertem Haar, Bart und Koteletten stets einen neuen, nach der letzten Mode geschnittenen Anzug und hell eingelegte Schuhe trug, eine auffallende Krawatte umgebunden hatte und, eine Blume im Knopfloch, den steifen Hut verwegen auf einem Ohr, nach dem Theater auf den Pariser Boulevards sein elegantes Stöckchen durch die Luft wirbelte. Welches von diesen zwei Antlitzen Ravels — hier der asketische und schmerzvolle, dort der raffinierte und fast übermütige Dandy — ist das wahre? Ist diese scharfe Diskrepanz, diese rätselhafte Vielseitigkeit des Menschen Ravel von Bedeutung, wenn man sein musikalisches Schaffen richtig verstehen will?
Es gibt freilich zuerst einmal einen Ravel, der allgemein bekannt ist, der jedem Radiohörer oder Klavierschüler, der die modernen Franzosen studiert, leicht zugänglich ist. Werke wie der „Bolero“ haben viel dazu beigetragen, seine Popularität in allen Ländern zu verbreiten: er selbst erzählte, er habe öfters Pariser Arbeiter gehört, die das Thema seines Bolero genauso wie einen Schlager von Maurice Chevalier auf den Straßen vor sich hinpfiffen. Wer kennt auch nicht die „Pavane pour une infante dėfunte“, entweder in der Originalfassung für Klavier (1899) oder in der Ravelschen Instrumentierung, um nicht von den zahlreichen Arrangements für allerlei Instrumente zu sprechen? Es wäre aber ein Irrtum, es hieße sogar den echten Ravel verkennen, wollte man sich mit diesen volkstümlichen Werken begnügen. Man muß Ravel unbedingt näher betrachten und versuchen, aus anderen Werken das Echo einer tieferen Sensibilität zu vernehmen.
Diese zweite Etappe ist immerhin nicht schwer zu erreichen. Beim Anhören gewisser Kompositionen Ravels, hat man den Eindruck, daß ein Mensch vor uns steht, ein unbekannter und verschämter Romantiker, der sein Herz in lyrischen Ausbrüchen leidenschaftlich ausschüttet. Das schönste seiner Jugendwerke, das Quartett in F (1902) sprudelt nur so von frischer Poesie, von unbeschränkter Ursprünglichkeit: man glaubt in die kristallene Klarheit einer fröhlichen, unschuldigen Kinderseele zu blicken. Zur Mitte seines Lebens gelangt, menschlich wie künstlerisch gereift, scheint die Sensibilität Ravels ernster und dramatischer geworden zu sein. Eine Stelle aus seiner feenhaften Ballettoper „L’enfant et les sortilėges“ (1920 1925) strahlt eine ergreifende Dramatik aus: man denkt da entweder an die berühmtesten Liebesszenen der italienischen Opern oder noch an den schmerzerfüllten 3. Akt von Debussys „Pellėas et Mėli- sande“, wenn die zwei jungen vom Schicksal Gezeichneten voneinander Abschied nehmen müssen. Die Handlung von Ravels Zauberoper ist wohl bekannt: des banalen Glücks des Heims und des ruhigen Familienlebens müde, zerschlägt ein schlimmes Kind die Möbel und mißhandelt die Tiere in einem Anfall von fieberhafter Ungezogenheit. Die Hausgeister aber rächen sich. Die Möbel werden zu lebendigen Wesen und die Flammen des Kamins züngeln gegen den Knaben. Seine erste Liebe, die Märchenprinzessin, verläßt ihn. Sie ist die symbolische Fee der menschlichen Unschuld, die vergebens versucht, das kleine Menschenkind zu rühren. Sie verläßt ihn nach einem herzzerreißenden Abschied, und man könnte direkt glauben, daß Ravel uns in diesem Dialog, den nur eine wehmütige Flöte begleitet, das „Bruchstück einer großen Konfession“ anvertraut hat.'
Ravel ist immer ein großer Freund der Natur, der Landschaft und der Tiere gewesen. Im Wald von Rambouillet, der das Dorf Montfort l’Amaury, in dem er wohnte, umrahmt, machte er öfters lange, einsame Spaziergänge. Zwar war er weder ein Entomologe noch ein Sammler von seltenen Pflanzen. Er fühlte sich aber mitten in der einfachen, alltäglichen Natur der Ile de France ungemein wohl. Mehr noch: er liebte, er bewunderte die Tiere. Er hat sich nicht damit begnügt, den von Colette in „L’enfant et les sortilėges“ erdichteten Tieren eine fast menschliche Seele zu verleihen, so daß sie es sind, die den bösen, aber schließlich unglücklichen und verwundeten Knaben aufheben, verbinden und zur Mutter nach Hause tragen. Ravels Wohnung, wo er allein mit einer ihn mütterlich umsorgenden Wirtschafterin lebte, war voll von Tieren. Er hatte vor allem die Katzen sehr gern, die sein Dasein teilten, unbekümmert auf seinen Schreibtisch sprangen und manchmal die Spuren ihrer eigenwilligen Krallen auf seinen Manuskripten hinterließen.
Vielleicht könnte man jetzt meinen, daß Ravel unter diesen Umständen seinen Freunden, den Tieren, Werke von hinreißender Lyrik gewidmet und sie, wie in „L’enfant et les sortilėges“, immer verklärt und verherrlicht habe. Weit gefehlt! Das diesbezüglich bei weitem charakteristischeste Werk, was Form, Harmonie, Technik und Inspiration betrifft, der Liederzyklus „Histoires naturelles“ (1906) nach dem sarkastischen Text von J. Renard, bildet eine Folge von schonungslosen Karikaturen, die die lächerlichsten Tiere, wie das Perlhuhn, oder die eitelsten, wie den Pfau oder den Schwan, oder noch die unpoetischesten und kleinlich arbeitsamsten, wie die Grille, mit einer Art geheimem Sadismus und spöttischem Lachen schildern. Um eine so beißende Ironie den Tieren gegenüber zu verstehen, muß man nämlich wissen, daß viel mehr noch als die lebenden Tiere deren künstliche Kopien Ravel unwiderstehlich anzogen. Automaten, die die Bewegungen und Sprünge, die ganze Mimik und die Grimassen der Tiere nachahmten, und im allgemeinen alle von Menschenhand konstruierten Geschöpfe, die imstande sind, natürliches Leben zu fingieren, erschienen Ravel am geeignetsten, den gegenstandslosen Irrealismus jedes Wesens zu dokumentieren und zugleich die Sehnsucht nach einer anderen Welt zu symbolisieren, einer Welt nämlich der Harmonie, der Exaktheit und der mathematischen Vollendung, aus der die Unordnung und der Schmerz verbannt wären. Und in der Tat war eines der ersten, nachhaltigsten Kindheitserlebnisse Ravels die Bekanntschaft mit der mechanischen Ente von Vaucanson. Sein Arbeitszimmer war voll von Kinderspielzeug, Attrappen, chinesischen oder japanischen Miniaturgegenständen, die ihm den Eindruck einer liliputartigen Welt vermittelten, über die er wie ein neuer Prometheus schalten und walten konnte.
Das Dahinjagen der Zeit ängstigte ihn aber wie ein Alpdruck: Für Uhren empfand er zugleich Leidenschaft und Haß; in „L’enfant et les sortilėges“ schreibt er wohl einer alten Standuhr eine menschliche, sympathische Rolle zu: Diese Uhr wird vom bösen Kind zerschlagen, so daß sie sich ganz beschämt fühlt, nach langen Jahren treuer Dienste, so nutzlos, ohne Pendel mit aufgerissenem Bauch dastehen zu müssen. In Ravels erster Oper „L’heure espagnole“ (1907) ist es jedoch der nervenzerrüttende, kaltschelmische Rhythmus der Uhren des Uhrmachers Torquemada, der die lächerlichen, tragikomischen Intrigen begleitet und skandiert, die alle Personen — lauter Marionetten in fingiertem Liebeskummer — zu erleben scheinen. In das Gehäuse selbst von zwei großen Uhren müssen sich die beiden lächerlichen Bewerber der schönen Concepcion verstecken, während der verlachte und gehörnte Gatte die Stadtuhren zu regeln versucht, während die ungetreue Gattin, oben im 1. Stock, mit dem rüstigen und siegreichen Maultiertreiber aus Estramadura, Ramiro, Eros das ungeduldig ersehnte Opfer darbringt.
Unter diesem buffoartigen Gewand kommt eine gewisse Skepsis der menschlichen Liebe gegenüber, man kann sogar sagen, ein finsterer Pessimismus unverkennbar zum Vorschein, als wäre die innerste Seele Ravels von einem rätselhaften, verborgenen Affekt heimgesucht worden. Keine Frau scheint in seinem Leben auf: und doch war er alles eher als ein Menschenfeind; er hatte zahlreiche wahrhaft gute Freunde; mehrere Frauen, seine Interpretinnen vor allem, gehörten zu seinem engeren Kreis. Die wahre „Liebe“ scheint ihm aber vollkommen unbekannt geblieben zu sein, als hätte ihn der unerwartete Tod seiner Mutter (1917), der ihn für mehrere Monate in einen pathologischen Zustand der Verzweiflung gestürzt hatte, auf immer für ein echtes, totales „Mitsein“ unfähig gemacht. Immerhin scheint ein verborgener Schmerz an Ravels ganzem Leben genagt zu haben. Manchmal hat er in einen stolzen Aristokratismus, in eine Art harten, fast unmenschlichen Stoizismus dem Leben, dem Tod und sich selbst gegenüber, seine Zuflucht genommen. Dep ravelsche Stoizismus taucht in dem wenig bekannten Lied „Ronsard ä son äme“ (1924) nicht nur im Ausdrude eines stolzen Entsagens auf, sondern er findet auch in der musikalischen Schreibweise seinen Niederschlag. Der Klavierpart ist asketisch gestaltet und scheint die harmonische Üppigkeit zu verhöhnen, die Ravel in anderen Werken so oft und so geschickt zu Wort kommen läßt. Dieselbe bewußte Beschränkung charakterisiert auch das symphonische Präludium der Oper „L’enfant et les sortilėges“, in dem Ravel durch eine ähnliche Reihe von leeren Quarten denselben Verzicht, dasselbe Desinteressement zum Ausdruck bringt. Diese unbarmherzige Selbstironie macht manchmal einer blinden Wut Platz: plötzlich legt er diese Maske aristokratischer Größe ab. Eine Art kalten Zornes ergreift ihn dann, und er verlacht sich selbst auf fast selbstquälerische Weise, die durch die Virtuosität der Technik nicht vollkommen überdeckt wird.
Eben auf diese Weise kommt man wahrscheinlich endlich
> auf den richtigen Weg, der erlauben mag, wenn schon nicht das Rätsel des Menschen zu lösen, so doch die erstaunliche Verschiedenartigkeit seines musikalischen Schaffens zu verstehen. Durch das reine ,,1’art pour l’art“ und die pure Gratuität der Kunst hat Ravel nämlich die innere Befreiung erstrebt und erlangt und auf diese Weise seiner Aussage einen exemplarischen Wert verliehen. Ravel hat zuerst in der sagenhaften Welt des Ostens, in den feenhaften Träumen der Kindheit oder im Phantastischen seine Befreiung gefunden. Die Märchenprinzessin in „L’enfant et les sortilėges“ mag wohl vom Knaben einen dramatischen Abschied nehmen. Ravels eigene Fee hat ihn selbst nie verraten. Sie wurde zuerst die prunkvolle Fee aus Tausendundeiner Nacht, die er in einem zauberhaften Liederzyklus „Scheherezade“ (1903) besungen hat. Er wird nicht immer die glanzvolle Dichte des Orchesters beibehalten: er wird im Gegenteil manchmal in die paradiesische Welt der Kindheit durch viel bescheidenere Mittel Einlaß finden. In der Welt von Perrault und Madame d’Aulnoy („Ma mere l’Oye“, 1908) oder noch in der traumhaft kindlichen Atmosphäre von Colette fühlt er sich instinktmäßig zu Hause. Dort hat er die Kindheit zurückgewonnen: eine glückliche oder betrübte Kindheit, mit ihren unschuldigen Spielen oder im Gegenteil mit ihren bösen Streichen; mit ihren sorglosen Träumen oder im Gegenteil mit dem Alpdruck der Schulaufgaben, der Arithmetik, mit dem schauderhaften Bewußtsein jener Verschwörung aller Dinge gegen das menschliche Glück, bis endlich doch die gegenseitige Liebe der Mutter und des Kindes diesem aus den Fugen geratenen Miniaturkosmos wieder einen annehmbaren Sinn verleiht.
Die Welt der Kindheit oder des Phantastischen sagt aber nicht das letzte Wort über die musikalische Persönlichkeit Ravels: er hat auch durch den schwerelosen, immateriellen Rhythmus des Tanzes die Befreiung errungen. Dabei denkt man gewöhnlich, und übrigens mit Recht, vor allem an die spanischen Rhythmen, die manche seiner Werke charakterisieren. Von seiner Mutter hatte er einen angeborenen Instinkt für jene iberischen Tänze geerbt, die seinen berühmtesten Werken, von der „Habanera“ (1895) bis „Don Quichotte“ (1932), ihr Gepräge verleihen. Man denkt auch des öfteren an den Rhythmus des Walzers, der für seine Inspiration maßgebend gewesen ist und dem er bekanntlich eine seiner besten symphonischen Kompositionen („La Valse“ 1920) gewidmet hat. Viel charakteristischer noch erscheint aber endlich eine Reihe von Werken, in denen Ravel den wahrsten Ausdruck seines rhythmischen Genies dokumentiert, in denen er die Tänze der Barockzeit verwendet hat. Hatte er erst 1917 in „Le tombeau de Couperin“ eine Gesamthuldigung für den Geist und den raffinierten Stil des Hoftanzes verfaßt, so darf man doch nicht vergessen, daß er schon 1909 sein Menuett auf den Namen Haydn geschrieben hatte, daß der Klavierzyklus „Ma mere l’Oye“ (1908) mit einer Pavane beginnt und daß er endlich das „Menuet antique“ bereits 1895 komponiert hatte. Ravel fühlt sich, ebenso wie in der feenhaften Welt der Kindheit, in der stilisierten, ironischen, fast irreellen Atmosphäre jenes französischen 18. Jahrhunderts zu Hause, das viel weniger aus Sinnenfreude als aus ästhetischem Drang nach formeller Schönheit und aus bewußtem Sehnen nach einer Welt des Traums und der Phantasie mit Watteau das Schiff nach Cythera besteigt.
Und aus diesem Grund hat Ravel schließlich in der stilisierten und zugleich feenhaften Kulturwelt Griechenlands der Antike seine echte seelische Heimat gefunden. Er hat sich ein ätherisches Bild des antiken Hellas erträumt, das mit seinem überfeinerten Ideal des klassischen 18. Jahrhunderts eine viel engere Verwandtschaft besaß als mit dem griechischen romantischen Realismus eines Richard Strauss. Es geht mit dem ideellen Griechenland Ravels genauso wie mit dem sagenhaften Indien von J. P. Rameau und sämtlicher Komponisten des 18. Jahrhunderts. Beides sind echt französische Schöpfungen, und eben in dieser Welt des freien Traums konnte Ravel, ein Mensch des Jenseitigen und ein souveräner Könner, seiner virtuosen Phantasie freien Lauf lassen. „Daphnis et Chloe“ (1906 1911) ist nicht nur der vollkommenste Ausdruck der instrumentalen Technik des Meisters, es ist auch die leidenschaftlichste Hymne des Menschen Ravel an den reinen Rhythmus, an den Gott des Tanzes, der in seiner Gratuität selbst seine Allmacht bekundet und sich bei alldem der formellen-Disziplin eines Stils selbstverständlich anpaßt. Ravel hat selbst gestanden, sein künstlerisches Ideal sei: „auf natürliche Weise kindlich“ zu sein. Gleichzeitig aber bleibt er der kristallklare, einfache, asketische und klassische Ravel, bei dem selbst Leidenschaft und Romantik jede unreine Schwere einbüßen, um vergeistigt und verklärt zum Ausdruck zu kommen.