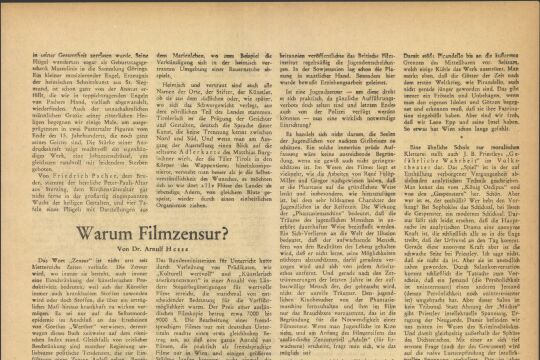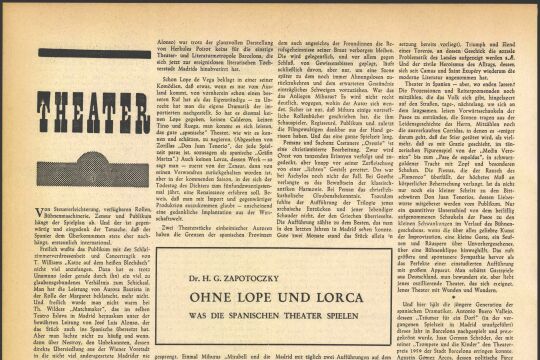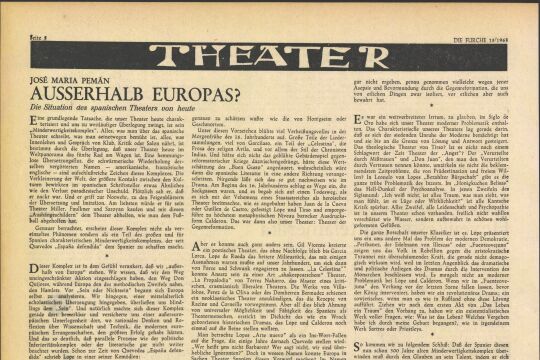Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Wiener Theater
Das Burgtheater brachte als letzte Neuinszenierung Lope de Vegas Schauspiel „D as Dorf in Flammen“ in einer neuen Übersetzung Franz Wellners zur Aufführung. Ein Abend .des historischen Interesses. Wann immer die klassischen Spanier auf dem Theater unserer Zeit auftauchen, sie sind voll sprühenden Lebens, voll drängender Aktion, voll einer gänzlich unklassizistischen Propaganda im Dienste einer staatlichen oder religiösen Idee. Im Gegensatze zu Calderons „Propaganda fidei“ ist Lope eine politische Natur. Lopes „Dorf in Flammen“ wurzelt in der staatlichen Einigung Spaniens unter einer Königskrone, wie auch im Haß gegen die dezentralisierende Adelsschichte der Ordensritter. An seiner harten Stirne trägt es gleichsam den Leitspruch „In Tyrannos“ und ist eine Vorstufe der deutschen Anti-tyrannendraniatik der „Räuber“, der Freiheitsdramatik des „Wilhelm Teil“. Was Schiller im „Wilhelm Teil“ vorschwebte — der kollektive Heid eines Volkes —, das ist hier bei Lope mit kraftvoller Kühnheit bereits vorweggenommen. Das Dorf Fuente Ovejuna ist Zeichen für das ganze spanische Volk. Lope dringt hier bis zum Wesen des Volksstückes vor, da das Volksstück ja nicht darin sich ausprägt, daß es individuelle seelische Probleme in sprachlich volkstümelnde Wendungen verkleidet, wie dies die Bauerndramatik des 19. Jahrhunderts handhabt, sondern daß es eben überindividuelle massenpsychologische Vorgänge lebendig darstellt. Und diese überindividuelle Psychologie hat Lope glücklich an jener seelischen Regung aufgezeigt, die ihrer ganzen Natur nach zur Gemeinschaft drängt: am Rechtsempfinden. Man könnte Lope in diesem Werk geradezu als Dramatiker des Naturrechts bezeichnen, wäre Lope eben doch nicht in erster Linie Dramatiker des Lebens und kein Idealist der Freiheit wie Schiller. So kommt es denn auch, daß jene Stellen des Werkes am frischesten geblieben sind, die die einfachen natürlichen Empfindungen des Bauernvolkes darstellen, wie erstes Finden der Liebenden, Brautwerbung und Hochzeit. Von dieser heute noch taufrischen Heiterkeit hebt sich die düster fressende Flamme des Komturs, ein abstoßendes Bild untergangsreifer Tyrannenwillkür, drohend ab. Eins möge nicht übersehen werden: Die Ordnung ist es, was das Volk von Fuente Ovejuna will. Und gegen den Störer der Ordnung erhebt sich das gesunde Rechtsempfinden des Volkes in flam.ncndem Aufruhr. Mit der Huldigung an den König schließt das merkwürdige Stück. Das ist nicht Raserei um ihrer selbst willen, wie in so manchen nihilistischen Revolutionsdramen der Moderne, das sind keine Weber, das sind keine Maschinenstürmer oder Ludditen.
Ist nicht diese Art von Empörung des gesunden Rechtsempfindens zeitgemäß? Man kann es den Aufruhr der Ordnung im Gegensatz zum Aufruhr des Chaos nennen. So genommen hat das Burgtheater einen guten Griff in die Weltliteratur getan, der wohl die Kraft hat, Spiegel der Gegenwart zu sein. Die Aufführung als solche war mittelmäßig und hatte keinerlei Ambition.
Das Akademietheater hat mit der Komödie „Einmal ist genug“ von Frederik Lonsdale ein mit Witz geladenes Werkchen zur Aufführung gebracht, das dem sommerlich aufheiterungsbedürftigen Theaterbesucher drei Akte lang lachen läßt. Quelle dieses Lachens ist der pointierte Dialog, das „Bon mot“ — eine Abart des „Bon mot“, das logischen Witz mit Gemüt wohl auszugleichen weiß. Damit die kühle Oskar Wildsche Ironik und Aphoristik nicht das Übergewicht bekommt, sorgt Lonsdale auch für die mehr gemüthafte Seite. Alles in allem ein über dem Durchschnitt stehendes Unterhaltungsstück mit Geist. Geist ist Mangelware und sollte immer dankbar genossen werden. •
Das Theater in der Josefstadt spielt derzeit Edouard Bourdets Komödie „Feine Gesellschaft“. Ein Milieustück aus der Welt, in der man sich nicht langweilt. Eigentlich eine moralische Komödie. Eine Komödie, die nicht genau weiß, ob sie die in ihr vertretene Moral auch bis zur letzten Konsequenz verteidigen soll. Denn der Leitgedanke dieser Studie aus dem Reiche der unteren Zehntausend ist der, „es gibt keine anständigen Menschen“. Natürlich muß da Bürgertum herhalten, am darzutun, daß es eine „verlogene Moral“ hat, wie es immer so schön heißt. Man entdeckt bei diesem Stück bald, daß das Moralkritische und Tendenziell die schwache, ja die absolut zu verurteilende Seite des Werkes ist. Es ist nur schade, daß das ganze Stück im,Grunde witzlos ist. Bourdet versteht es aber so zu tun, als würde er den Zuschauer unterhalten, während er ihm mit jedem Wort jene oben angedeutete Moral predigt. Dieses scheinbare Amüsement verdankt der Zuschauer nur seiner geringen Vertrautheit mit dem dargestellten Milieu. Milieudramen sind grundsätzlich nur für Menschen geschrieben, die diesem Milieu nicht angehören. Die eigentliche Substanz des Dialogs ist dünn. Bleibt also als Resultat dieses Abends eine gute Aufführung, wie sie eben nur in der Josefstadt zu sehen ist. Von dem Wiener Milieu der Zeit vor dem ersten Weltkrieg zieht ein feiner Duft aus Lavendel herüber, der den Zuschauer zu sentimentalen Vorstellungen lockt, aber doch Ablehnung herausfordert.
Enttäuscht hat die letzte Sommerpremiere der „Insel“. So erfreulich es ist, in diesem Theater eine Avantgarde-Bühne zu besitzen, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, mit jungen Kräften seltene Stücke darzubieten, so wenig kann man damit einverstanden sein, daß sich dieser Avantgardismus als etwas Zurückgebliebenes einführt. Ostrowskis „Braut ohne Mitgift“ mag für Rußland in russischer Sprache etwas Klassisches haben, für uns sind die in diesem Stück gebotenen Probleme lange schon keine Probleme mehr, so daß man vergebens versucht, irgendeine Brücke zur Gegenwart zu finden. Dieses russische Aschenbrödel-Motiv liegt auf einem Niveau zwischen Märchen und Realistik, das nicht einmal Mitleid mit dem vom Unglück betroffenen Mädchen entlockt. Auch die drei reichen Kaufleute bleiben Mittelmaß. Vielleicht wirkt das Stück anders, wenn es in der Heimatsprache gespielt wird. Das scheinen auch die Schauspieler zu glauben, denn sie ersetzten — ohne viel Erfolg — das fehlende Russisch durch ein übertriebenes Pathos, vermischt mit russischer Akzentuierung, die mehr als fehl am Platze ist. Es ist zu hoffen, daß die „Insel“ in der neuen Saison das hält, was sie am Anfang ihrer Spielzeit versprochen hat.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!