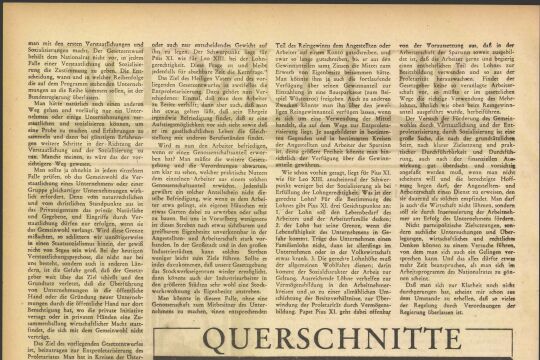Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
ZEUGE EINER ZEIT
Mancher mag sich noch an jene Wochenschauaufnahmen aus der unmittelbaren Nachkriegszeit erinnern, die Franz Theodor Csokor zeigten, als er zum erstenmal seit dem März 1938 Wiener Boden betrat und wiedergefundene Freunde umarmte, barhäuptig, das dichte graue Haar vom Wind zerzaust, in der Battledress, die er trug, seit er während des Krieges als Liaison Offleer in eine britische Militärdienststelle für psychologische Kriegführung eingetreten war. Für diese Tätigkeit hatte er selbst die lapidare Bezeichnung „Freud in Uniform“ geprägt. Damals, im April 1946, nach einem Flug in einem „pensionierten“ Bomber, fand ein freiwilliges Exil sein Ende, das Csokor durch „ungefähr fünfzig Bombardements und dazu noch das stärkste Erdbeben seit Messina“ (Bukarest 1940) geführt hatte. In Wahrheit aber hatte die erste Phase dieser Emigration, das „Leben neben den gepackten Koffern“, nicht 1938 begonnen, sondern bereits zu dem Zeitpunkt, als die Wahl Hitlers zum Reichskanzler in der Weltpresse Schlagzeilen machte. Aus jenen Tagen datiert einer der ersten der vielen Briefe an den langjährigen Freund Ferdinand Bruckner in Berlin, zu dessen großem Erfolg mit dem Zeitdrama „Krankheit der Jugend“ (1928) Csokor wesentlich beigetragen hatte. In der Rückschau sagt der Dichter darüber:
„Die Triebkraft war die Sorge um die Freunde. Sie, die in Berlin saßen, merkten oder spürten noch nicht, wie ich, der ich dieses österreichische“,Gspür' jür die Dinge habe, was das bedeuten würde, welch ungeheurer Umschwung sich durch dieses Ereignis in ihrem ganzen Leben vollziehen würde.“
Bruckner emigrierte mit seiner Familie rechtzeitig nach Paris und ging noch vor Ausbruch des Krieges nach Amerika. Csokor arbeitete in der bedingten Sicherheit der Heimat, über der die Schatten immer dichter wurden, weiter, sah sein Büchner-Drama „Gesellschaft der Menschenrechte“ mit Erfolg am Burgtheater aufgeführt und schrieb, zum Teil in Carl Zuckmayers Wiesmühle in Henndorf bei Salzburg, an jenem dramatischen Nekrolog auf das alte Österreich, der ursprünglich „Die Grablegung“ heißen sollte. In Gesprächen mit einem anderen seiner engsten Freunde, nämlich ödön von Horväth, entschied sich Csokor schließlich für den Titel „3. November 1918“, das Datum des Waffenstillstands. Die erste Anregung zu diesem Stück empfing der Dichter bereits Mitte der zwanziger Jahre durch eine simple Zeitungsnotiz.
„Damals las ich von einem Kriegsgefangenenlager in Ostsibirien, wo österreichische Kriegsgefangene lebten, die noch keine Ahnung davon hatten, daß die Monarchie zerfallen war. Für mich ist bei einem Stück sozusagen die .Abschuß-Stelle' wichtig, daß das Moment, an dem es sich entzündet, so stark ist, daß der Funke über das ganze Werk trägt. Dies war gegeben. Und an der Situation als solcher änderte sich nichts, wenn man als Schauplatz ein eingeschneites Rekonvaleszentenheim in den Karawanken wählte, dessen Telephonverbindungen unterbrochen waren. 1937 wurde“,3. November 1918' ein großer Erfolg am Burgtheater, ich bekam — nach Gerhart Hauptmann, Schnitzler, Schönherr und Max Meli — den Burgtheaterring und hatte Aussicht auf ein sogenanntes sicheres Leben, auf das ich nie sehr viel Wert gelegt habe, weil mich das andere Leben immer viel mehr interessiert hat. Wenige Monate später war ich ein namenloser Emigrant mit fünf Zloty in der Tasche.“
Chronikhafte Briefe müssen dem Exilierten Ersatz sein für die persönliche Begegnung mit den Menschen, die er liebt, Berichte über das persönliche und das Schicksal der Freunde, an Ferdinand Bruckner, an Lina Loos, die langjährige Vertraute, die in Wien geblieben war, an die Mutter, die Schwestern und an Ödön von Horväth, der sich, von dunklen Vorahnungen bedrängt, in der Schweiz eine kurze Atempause gönnte, ehe er nach Paris weiterfuhr. Ein Brief Csokors an Horväth, am 31. Mal 1938 auf einem Gut im polnischen Industriegebiet geschrieben, kam ungeöffnet an den Absender zurück. Am 1. Juni war der Dichter auf den Champs Elysees von einem herabstürzenden Ast erschlagen worden. Von den Briefen, die ödön von Horväth an Csokor geschrieben hatte, sind nur mehr wenige erhalten, die meisten gingen in Bukarest verloren. Csokors Briefe an Ferdinand Bruckner hingegen, die den Hauptteil des vor kurzem im Verlag Langen-Müller (München—Wien) erschienenen Bandes „Zeuge einer Zeit“ ausmachen, gelangten nach dem Tod des Dramatikers wieder in die Hände ihres Verfassers.
„Mein Freund Bruckner hatte testamentarisch bestimmt, daß mir auf Wunsch der gesamte Briefnachlaß zur Verfügung zu stellen sei. Seine Witwe schickte mir das Material aus Amerika. Und beim Sichten erkannte ich, daß hinter diesen Briefen die ganze Zeit aufsteht. Vom Tag der Machtergreifung Hitlers an über die Tragödie Österreichs bis zum Kriegsende ist diese Epoche gegenwärtig, so deutlich, wie sie nur aus dem unmittelbaren Empfinden eines Menschen, der diese Zeit in jeder Form miterlitten hat, sprechen kann.“
In Polen, dessen Unabhängigkeitserklärung am 8. Oktober 1918 Csokor selbst miterlebt hatte und das ihn als Autor der erfolgreich aufgeführten deutschen Bühnenfassung von Krasinskis „Ungöttlicher Komödie“ ehrte, bewahrheitete sich für Csokor das polnische Sprichwort „Gast im Haus, Gott im Haus“, bis ihn der Lauf der Ereignisse wieder, ohne das schützende Medium der Gesellschaft, „Aug' in Auge mit der Geschichte“, konfrontierte.
„Meine Wanderschaft führte durch den zusammenbrechenden polnischen Staat und im Gefolge der polnischen Armee über die Grenze in das damals noch friedliche Rumänien, das ich bald wieder verlassen mußte, in das noch im tiefen Frieden lebende Belgrad, auf das vierzehn Tage später die Bomben fielen. Und dann kreuzte ich wieder ein Land im Krieg, kam dank der Hilfe von Ivan Mestrovic auf die Insel Kordula, wo bereits der Partisanenkampf aufflackerte — dort begegnete ich auch Alexander Sacher-Masoch — und zwei Jahre später, nach dem Waffenstillstand zwischen Italien und den Alliierten, gelangte ich auf einer dicht mit Menschen besetzten kleinen Trabakel der Partisanen nach Bari, wo ich als Liaison Officer in den Verband der Britischen Armee eintrat.“
1946 kehrte der Dichter nochmals nach Italien zurück und verbrachte nach der Auflösung seiner Sonderdienststelle ein Jahr in Rom, ehe er sich wieder in Wien niederließ, im dritten Bezirk, seinem „Schicksalsbezirk“, wo er als Sohn eines Professors der Tierärztlichen Hochschule geboren worden war, bis 1938 gewohnt hatte und nun wieder seit fast zwanzig Jahren inmitten vieler Bücher, Briefe, Manuskripte und Erinnerungsstücke seine Heimstatt hat.
Erster schriftstellerischer Niederschlag der Emigrationserlebnisse waren die Bücher „Zivilist im Polenkrieg“ (in Amsterdam und bereits 1940 in englischer Ubersetzung in London erschienen) und „Zivilist im Balkankrieg“, die beide vor einiger Zeit in dem Band „Auf fremden Straßen“ (Desch) vereinigt wurden.
Zivilist im Sinne von Individualist, als einzelner im Kampfeld militärisch-politischer Machtapparate, dies war Csokor in jenen Jahren, Zeuge einer Zeit, mehr noch: des Geschehens in der Feuerzöne.
„Ich weiß keinen meiner emigrierten Kollegen, der immer so knapp an den Kriegen vorbei- und durch die Kriege hindurchgegangen ist wie ich. Emigration war für mich eine durch keinerlei rassische Gegebenheiten bedingte Gewissensfrage.“
Oder mit anderen Worten, die Csokor bereits 1935, im Vorgefühl des Kommenden, an Ferdinand Bruckner geschrieben hatte:
„Unsere große Mutter, die Not, läßt uns entweder an ihr wachsen oder an ihr untergehen. Zuweilen auch beides. Gut nur, daß über diese zerstörte Welt noch ein Netz von Herzen geht, die füreinander da sind.“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!