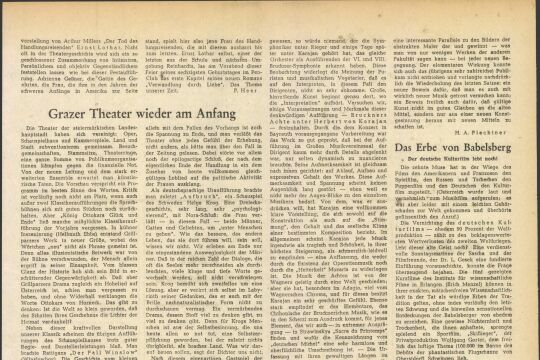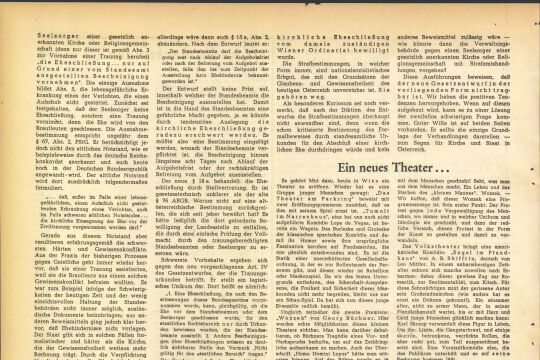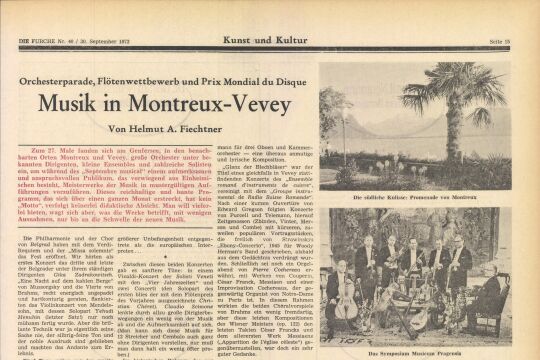Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Aus dem Konzertsaal
Das erste Abonnementkonzert der Wiener Kulturgesellschaft bot — neben Cesar Francks „Symphonischen Variationen“ für Klavier und Orchester und Anton Bruckners 1. Symphonie — eine Uraufführung: Karl Haidmayers IV. Symphonie, beim Kompositionswettbewerb der Wiener Kulturgesellschaft, für den sie eigens geschrieben wurde, preisgekrönt. Haidmayer, dessen erste Symphonie und dessen Flötenkonzert bereits durch das Orchester der Kulturgesellschaft uraufgeführt wurden, ist Grazer. Erklärungen zu seinem Werk hält der Professor für Komposition an der Musikakademie nicht für notwendig. „Das“ — so versichert das Programmheft — „charakterisiert am besten den Standort seiner Musik, die nicht, wie es heute oft der Fall ist, langer Erläuterungen und Analysen bedarf, um verstanden zu werden.“ Das kurze, dreisätzige Werk bedarf in der Tat keiner Anweisung für den Zuhörer. Seine vitale Sprache und vor allem seine rhythmisch überzeugende Struktur ist leicht verständlich. — Gwenneth Pryor, vom Publikum der Kulturgesellschaft bereits geschätzt, war die Solistin des Abends. Das Orchester der Wiener Kulturgesellschaft, unter Josef Maria Müller, spielte ambitioniert und hatte auch vor Bruckner keine Scheu.
Zwei Brahms-Sonaten (e-Moll, op. 38,
f-Dur, op. 99) und die „Zauberjloten - Variationen Beethovens bildeten das Programm des Abends, den Antonio Jani- gro und Jörg Demus im Großen Konzerthaussaal einem interessierten und dankbaren Publikum boten. Janigros Bogenstrich, im Ton ein Mezzoforte selten übersteigend, ergänzte das klare, gelok- kerte Spiel Demus' auf das Beste. Zwei Künstler also, zwei Partner, deren Zusammenspiel kaum einen Wunsch offenließ. Besonders bei den „Zauberflöten“- Variationen.
H. F. M.
Im Mozartsaal gab Raymond Truard einen Debussy-Abend. Der hierorts kaum bekannte Pianist (in mittleren Jahren und schon auf mehr als 1000 Konzerte zurückblickend) gehört zweifellos zu den Besten seines Faches. Seine sympathische Erscheinung von ausgesprochen romanischem Typ und das bescheidene Auftreten erwecken zusätzliches Vertrauen. Durch die Auswahl der vorgetragenen Stücke (Childrens Corner, Estampes und zwölf unter dem Gesichtspunkt des größtmöglichen Gegensatzes aneinandergereihte Preludes) kam nicht nur der impressionistische Lyriker Debussy zu Wort, sondern auch der Humorist, der Rhapsode und Virtuose, der er war. Von dem letzten Werk, das Truard vortrug,
„L'Isle joyeuse“ aus dem Jahr 1904, sagte Debussy: „Ach, du lieber Himmel, wie schwer es zu spielen ist! Dieses Stück scheint mir alle Arten des Klavierspiels zu vereinen, denn es verbindet Kraft mit Grazie.“ Kraft und Grazie: sie finden sich auch im Spiel von Raymond Truard, und das war vielleicht das Schönste daran.
Das zweifellos interessanteste Konzert der Woche veranstaltete das Ensemble „die reihe“ unter Friedrich Cerhas Leitung im Brahmssaal für die Musikalische Jugend. Die beiden, den ersten Teil einrahmenden Fünf-Minuten-Symphonien von Darius Milhaud aus den Jahren 1907 und 1921, fügen dem bekannten Bild des Komponisten keine neuen Züge hinzu. — Eines der frühesten Werke Debussys, die „Chansons de Bilitis“ von 1886, deren Originalmanuskript vor kurzem entdeckt wurde, sind deshalb so rührend, weil hier wirklich im Keim schon alles enthalten ist, was Debussys spätere Meisterwerke charakterisiert. Dabei handelt es sich nur um kurze Instrumentalzwischenspiele, die er zu zwölf Gedichten seines Freundes Pierre Louys schrieb, zierliche Miniaturen auch sie, die von Marie-The- rese Escribano in tadellosem Französisch rezitiert wurden. — Für sein surreales Theaterstück „Le Piėge de Meduse“
schrieb Eric Šalie 1913 sieben kurze Tanzstücke für einen Affen, deren jedes 20 bis 30 Sekunden dauert und die in ihrer karikaturistischen Verkürzung an die „Suite“ von • Strawinsky erinnern. Im zweiten Teil des Programms stand „Die unbeantwortete Frage“ von Charles įves (1874—1954) für drei „Gruppen“: Ein unsichtbar hinter einem Vorhang spielendes Streichorchester, das einen Choral intoniert, eine Trompete, welche die immer gleiche kurze Frage stellt, und eine Gruppe von vier Holzbläsern, die diese unruhig-drängend beantworten. Die ganze Komposition, etwa sieben Minuten dauernd, ist sehr reizvoll, spannend und in ihrer formalen Anlage in die Zukunft (auf Stockhausen etwa) weisend. — Zum Abschluß: Schönbergs „Kammersymphonie“ für 15 Instrumente, aus dem Jahr 1906, ein Schlüsselwerk nicht nur im Gesamtopus Schönbergs, sondern auch der neuen Musik, schon seinem Umfang nach (etwa 20 Minuten) das weitaus gewichtigste des Konzerts, zugleich auch der Tradition viel mehr verhaftet und verpflichtet, als die besprochenen Stücke der Franzosen und des Amerikaners įves, und damit sowie durch ihren Ernst und ihr Pathos — eine typisch „deutsche“ Musik.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!