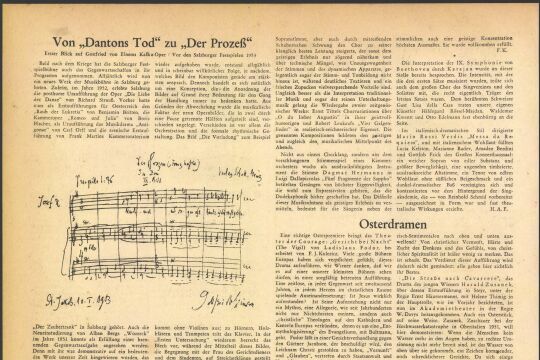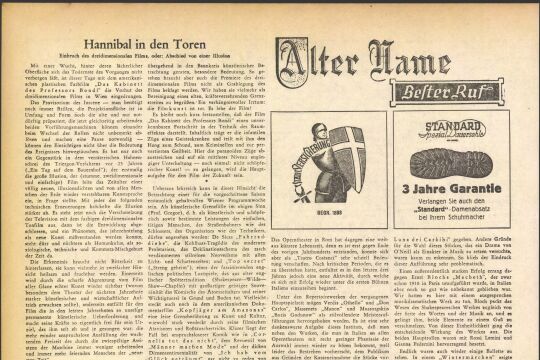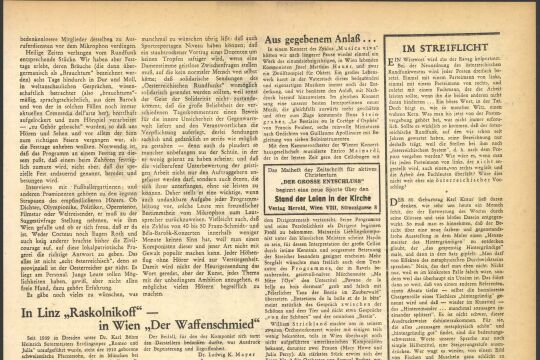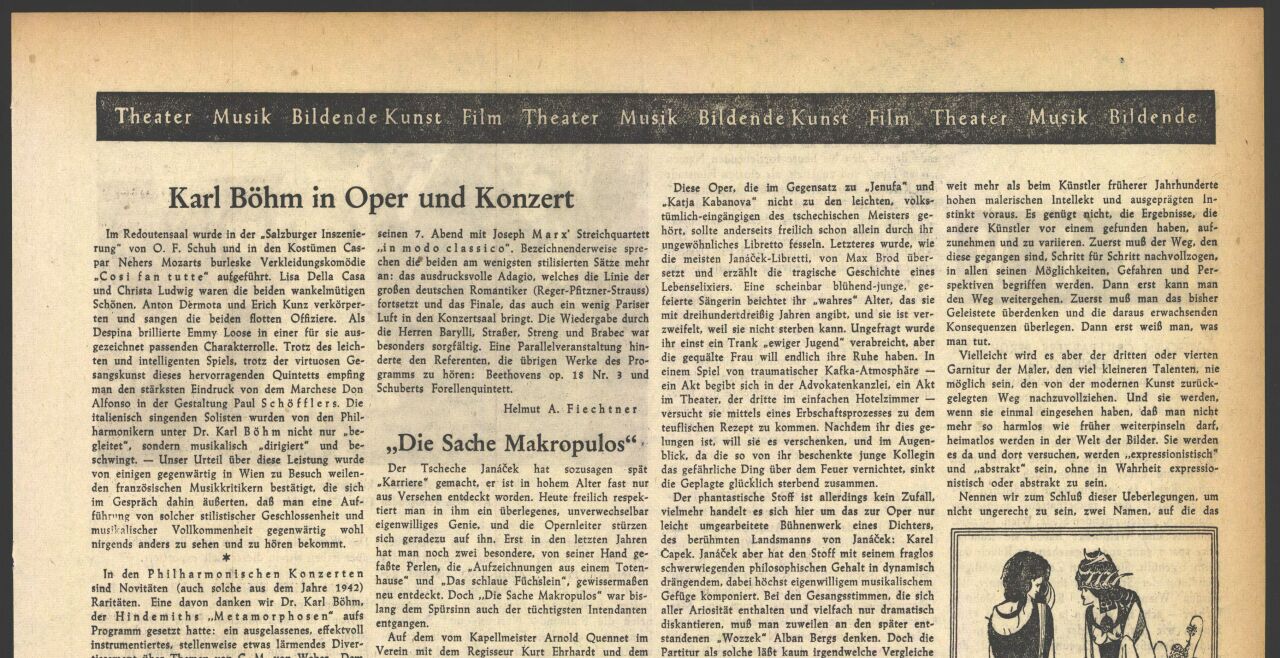
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
„Die Sache Makropulos”
Der Tscheche Janäcek hat sozusagen spät „Karriere” gemacht, er ist in hohem Alter fast nur aus Versehen entdeckt worden. Heute freilich respektiert man in ihm ein überlegenes, unverwechselbar eigenwilliges Genie, und die Opernleiter stürzen sich geradezu auf ihn. Erst in den letzten Jahren hat man noch zwei besondere, von seiner Hand gefaßte Perlen, die „Aufzeichnungen aus einem Totenhause” und „Das schlaue Füchslein”, gewissermaßen neu entdeckt. Doch „Die Sache Makropulos” war bislang dem Spürsinn auch der tüchtigsten Intendanten entgangen.
Auf dem vom Kapellmeister Arnold Quennet im Verein mit dem Regisseur Kurt Ehrhardt und dem Bühnenbildner Heinz Ludwig glänzend vorbereiteten Terrain der Deutschen Oper am Rhein, Düsseldorf, ging, mit so außerordentlichen sängerischen Leistungen wie denen von Frau Hildegard Hillebrecht und Julius Patzak, ein bemerkenswertes Ereignis in Szene: die Wiederentdeckung der 1926 uraufgeführten und seit 1929 praktisch in der Versenkung verschwundenen dreiaktigen Oper „Die Sache Makropulos” von Leos Janacek.
Diese Oper, die im Gegensatz zu „Jenufa” und „Katja Kabanova” nicht zu den leichten, volkstümlich-eingängigen des tschechischen Meisters gehört, sollte anderseits freilich schon allein durch ihr ungewöhnliches Libretto fesseln. Letzteres wurde, wie die meisten Janäcek-Libretti, von Max Brod übersetzt und erzählt die tragische Geschichte eines Lebenselixiers. Eine scheinbar blühend-junge, gefeierte Sängerin beichtet ihr „wahres” Alter, das sie mit dreihundertdreißig Jahren angibt, und sie ist verzweifelt, weil sie nicht sterben kann. Ungefragt wurde ihr einst ein Trank „ewiger Jugend” verabreicht, aber die gequälte Frau will endlich ihre Ruhe haben. In einem Spiel von traumatischer Kafka-Atmosphäre — ein Akt begibt sich in der Advokatenkanzlei, ein Akt im Theater, der dritte im einfachen Hotelzimmer — versucht sie mittels eines Erbschaftsprozesses zu dem teuflischen Rezept zu kommen. Nachdem ihr dies gelungen ist, will sie es verschenken, und im Augenblick, da die so von ihr beschenkte junge Kollegin das gefährliche Ding über dem Feuer vernichtet, sinkt die Geplagte glücklich sterbend zusammen.
Der phantastische Stoff ist allerdings kein Zufall, vielmehr handelt es sich hier um das zur Oper nur leicht umgearbeitete Bühnenwerk eines Dichters, des berühmten Landsmanns von Janaček: Karel Čapek. Janäcek aber hat den Stoff mit seinem fraglos schwerwiegenden philosophischen Gehalt in dynamisch drängendem, dabei höchst eigenwilligem musikalischem Gefüge komponiert. Bei den Gesangsstimmen, die sich aller Ariosität enthalten und vielfach nur dramatisch diskantieren, muß man zuweilen an den später entstandenen „Wozzek” Alban Bergs denken. Doch die Partitur als solche läßt kaum irgendwelche Vergleiche zu, sie ist von einer prachtvollen Farbigkeit und Rhythmik und mit einem äußerst glücklichen Instinkt sozusagen jenseits aller Berechenbarkeit instrumentiert, wobei die koloristischen Stellen noch am ehesten Foklore anklingen lassen, die rhythmischen Aspekte indes rundweg auch den Jazz einbeziehen.
Jedenfalls soll man dieses eigentümliche Werk unbedingt kennenlernen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!