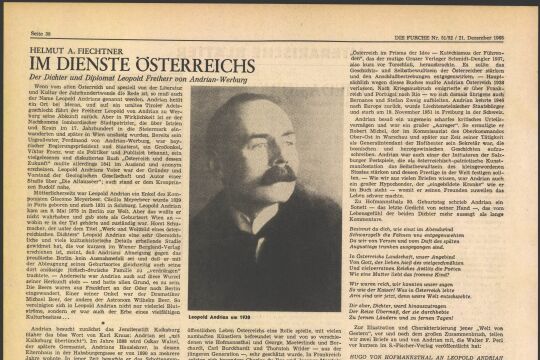Dichter zwischen zwei Welten
Sechsundzwanzig Jahre nach seiner Geburt stand die Heimat noch unter den Schwingen des Doppeladlers. Mag sein, daß der zweiköpfige Vogel als Symbol zu deuten ist für einen Dualismus der Seele und der Sinne, der den Dichter Josef Weinheber in hohem Maße charakterisierte. Wer das Schweben und Leben zwischen zwei Weltanschauungen, das Zwiespältige der großen, aber so tragischen Erscheinung des Dichters erkennen und werten will, greife zu den „Selbstbildnissen“. Dieses Wörtchen „selbst“ spielte keine geringe Bolle in seinem dramatischen Dasein. Aus diesen Selbstbetrachtungen, Selbstanalysen und Selbsterkenntnissen entstanden Weinhebers „Selbstbildnisse“ und führten über Selbstvorwürfe und Selbstanklagen zur Selbstzerfleischung und — Selbstvernichtung.
Sechsundzwanzig Jahre nach seiner Geburt stand die Heimat noch unter den Schwingen des Doppeladlers. Mag sein, daß der zweiköpfige Vogel als Symbol zu deuten ist für einen Dualismus der Seele und der Sinne, der den Dichter Josef Weinheber in hohem Maße charakterisierte. Wer das Schweben und Leben zwischen zwei Weltanschauungen, das Zwiespältige der großen, aber so tragischen Erscheinung des Dichters erkennen und werten will, greife zu den „Selbstbildnissen“. Dieses Wörtchen „selbst“ spielte keine geringe Bolle in seinem dramatischen Dasein. Aus diesen Selbstbetrachtungen, Selbstanalysen und Selbsterkenntnissen entstanden Weinhebers „Selbstbildnisse“ und führten über Selbstvorwürfe und Selbstanklagen zur Selbstzerfleischung und — Selbstvernichtung.
Mit einer Bescheidenheit ohnegleichen läßt Weinheber die Menschen in sein Inneres schauen, mit einem Bekenntnis, das oft ein Schrei der Verzweiflung ist. Viele berühmte Maler stellen sich in Selbstbildnissen dar, teils narzißtisch — also krankhaft verliebt in ihr eigenes Wesen—, teils in gerechter Wertung oder karikierend, aber nicht immer und nicht für jeden wurde sichtbar, was hinter der oft täuschenden Fassade eines Gesichtes stand. Weinheber deklarierte sich unmißverständlich. Selbst Maler, sah er gern in einen geistigen Spiegel, der nie ein Zerrspiegel war. Was er erschaute, gab er, schonungslos gegen sich selbst, preis, ja, stellte es mitunter masochistisch an den Pranger. Er hinterließ erschütternde Zeitporträts in Versen und Prosa. Immer wieder zeigte er uns die zwei Welten — die Welt um ihn und die Welt in ihm.
Götter und Dämonen
Virtuos verstand Weinheber, im Handumdrehen sein eigener Antipode, sein Gegner, zu sein. Und dieser „Wanderer zwischen beiden Welten“, der Dichter zwischen „Göttern und Dämonen“, zwischen „Adel und Untergang“, sah das Leben „von beiden Ufern“, stand zwischen „Sappho“ und „der Fräuln vom Neunerhaus“, zwischen dem griechischen Dichter „Asklepiades“ und dem „Gflicktn Schani vom scharfen Eck“. Wie im Schöpfungsplan Berge und Täler, Tag und Nacht ihren Bestand haben, beherrschte der Dichter das Hochüberlagerte nicht weniger als das Tiefabgründige, das Streben nach der Höhe ebenso, wie den Zug nach der Tiefe. Gesteigertes Selbstbewußtsein und übertriebene Selbstverachtung konnten sprunghaft wechseln — er brauchte beide wie die Weinseligkeit und den Katzenjammer. Freunde wissen zu berichten, daß der Dichter seine schöpferischen Stunden weniger im Zustand der Berauschung fand, als in der Ernüchterung und Erniedrigung. Wer vermeint, Weinheber hätte in trunkenem Zustand seine Verse geschrieben, irrt, wer vermeint, er hätte nur in strohnüchternem Zustand gedichtet, irrt ebenfalls. Das endgültige Kunstwerk entstand wohl im Wechselspiel von Stimmungen, die gleichfalls in zwei Welten beheimatet waren. Wohl überkamen ihn, wenn er „tiefen Blickes das Glas ergriffen“ hatte, schöpferische Ideen. Da mußten Speisekarten, Rechnungszettel, Zigarettenschachteln und Bierdeckel für flüchtige Anmerkungen herhalten. Am nächsten Tage werkte er dann hart zwischen der Welt des Ingeniums — der Erfindungskraft —, der Inspiration — der Eingebungskraft — und jener Tretmühle der Transpiration — der Ausscheidung. Da begann die Fronarbeit des Kunsthandwerks, das Ziselieren, das Feilen und Schleifen, das Facettieren, das Zurechtschnei-dern des eben gefundenen Versmaßes, das Suchen nach unverkrampften Reimen, die Schaffung des vollendeten Gusses. Da überkam ihn nur noch die Berauschung am Wort — mag für Intuition — gefühlsmäßige Erkenntnis — und In-stimultation (Einflößung) auch der Wein als Treibstoff der seelaschen Motorik — gewirkt haben. Von Li-Tai-Pe stammt das Wort, das Gustav Mahler in unsterbliche Musik gesetzt hat:
Ein Becher Wein, zur rechten Zeit, ist mehr als alle Reiche dieser Erde! Josef Weinheber, von dem Journalisten, Schriftsteller, Dramaturgen und Burgtheaterdirektor Mirko Je-lusich Lfl-Tai-Peperl genannt, hatte mit dem großen chinesischen Anakreon nicht nur die Sympathie für Bacchus, den Gott des Weines, gemeinsam, nicht nur die hohe Kunst des Verses: Beide Dichter, der aus der Tang-Zeit und der aus der Zwang-Zeit, wurden gegen ihre wahren Überzeugungen von den Mächtigen des Reiches vor deren Triumphwagen gespannt.
Das Zwiespältige
Eines muß doch endlich klar ausgesprochen werden: Weinheber hat nicht die Politik — nein, sie hat ihn mißbraucht. In seinem Buch „Hier ist das Wort“ findet sich ein Abschnitt: „Das angewandte Gedicht.“ Was er aber in keinen seiner Sammelbände aufgenommen wissen wollte, war das „anbefohlene Gesicht“, das ihm in der weinlosen, der schrecklichen Zeit mit Gumpoldskir-chen oder Moselgewächsen abgegolten wurde, wie übrigens auch seine Vorlesungen. Da stand er wieder zwischen zwei Welten, der des totalitären Zwanges — „Geehrt hat mich die Macht, doch nicht gefragt“ .— und der seiner inneren Anschauung.
Es ist kein Zufall, daß von Weinheber zwei Gedichte mit dem Titel „Janus“ stammen. Das Zwiegesich-tige ist die Dominante seines Lebens: „Und wie ich gut gewollt und wie ich bös getan.“ Es ist das „magische Zwiespältige“, das Weinheber in sich trug.
Was er Mozart zuschreibt, „da wird der Abgrund erst der Dissonanzen von letzter Weisheit Güte überbrückt“, war Weinhebers eigenes Lebensstreben. Und hier war das Dissonierende, die Unstimmigkeit, vor allem der Antagonismus, der Gegensatz zu sich selbst, der Mißton des Gegensätzlichen in der eigenen Brust. Wie oft verzweifelte er an dem Brückenschlag „der letzten Weisheit Güte“. Immer wieder legte er in drängenden Selbstbildnissen seine „reinen Selbstbekenntnisse“ nieder. Wohnten zwei Seelen auch in seiner Brust? War er eine höchst differenzierte, biformale Seele? Er trug jedenfalls schwer an den zwei Welten, und immer wieder wechselte geballte Biodynamik mit verzweifelnder Resignation. Er, der sich an der Allmacht des Wortes begeisterte, erschauerte vor der Ohnmacht des Wortes.
In höchstem Maße war ihm die Polarität des Barockmenschen zu eigen, das Schwanken zwischen Weltlust und Todessehnsucht, zwischen überschäumendem Lebensgefühl und schmerzlichsten Depressionen. Gemahnt das alles nicht ein wenig an eine Figur von Weinhebers Landsmann, Johann Nestroy, nämlich an den „Zerrissenen“ und an das Wort: „Jetzt möcht i doch amal sehn, wer stärker is — i oder i?“ Das Leben zwischen zwei Welten war ein ständiges Schwanken zwischen Furcht und Hoffnung, zwischen Himmel und Hölle, „zwischen Lipp' und Kelchesrand“.
Gesicht und Antlitz
Die Schriftstellenin Maria Grengg (1889 bis 1963) sagte von Weinheber, „er hatte ein Gesicht und er hatte ein Antlitz“, und damit pendelte er wieder zwischen zwei Welten, der des grauen Alltags und jener der glückhaften Sternstunden. Sein Gesicht zeigte er, wenn er Fleisch-laberln machte — was er sich von niemandem nehmen ließ —, sein Antlitz trug er zur Schau, wenn ihm Verse im glykonisch-asklepiadi-schen Versmaß — in heilkräftigen, starken Versen — von den Lippen quollen. Das war offensichtlich eine Persönlichkeit mit doppeltem Boden, aber auf jedem der beiden Böden fand er Wesentliches, Unvergängliches. Er liebte nicht nur den guten Spruch, sondern auch den Widerspruch. Weinheber sagte zu seiner Freundin Maria Mahler: „Ich bin ein gläubiger Katholik“ und zu einer geistlichen Krankenschwester im Spital St. Pölten: „Ich bin ein Heide!“
Josef Weinheber war Dichter zwischen zwei Welten und zwischen zwei Weltkriegen. In diesen zwei Dezennien liegt wohl der Schwerpunkt seines Schaffens, da liegen seine zwei dichterischen Welten, ,,.4del und Untergang“ und „Wien wörtlich“. — Später war er bei den Machthabern nicht nur als Paradepferd beliebt, sondern auch als Enfant terrible gefürchtet. Immer wieder sagte er ihnen Wahrheiten, die sie sich nicht hinter den Spiegel steckten. Bipolarität hat Weinheber in ungezählten Versen verewigt.
Wo aber liegt der Ursprung dieser gegensätzlichen Pole? War bei dem Dichter der Frohsinn des Vaters ebenso vererbt wie der Trübsinn der Mutter?
Im Leben fast aller großen Männer gibt es klaffende Widersprüche im Denken, im Fühlen, im Handeln. Die Ursachen sind nicht immer klar — da . .lögen Erbanlagen ebenso mitspielen wie Umwelteinflüsse oder Schicksalsfügungen. Gab es nicht auch bei Josef Weinheber Kindheitserlebnisse, die einen seelischen Knick zur Folge hatten?
Wenn man Einblick in die Volks-schulklassenbücher des kleinen Peperl nimmt, so sieht man, daß diese Schulausweise weit mehr ausweisen, als man anzunehmen geneigt ist. Das Überraschende ist nicht aber der kleine Treppenwitz, daß der spätere Anbeter der „Göttin des Wortes“, der Dichter, dem eine hochgezüchtete Sprachkultur auch von seinen Gegnern bescheinigt wird, einen „Dreier“ in Unterrichtssprache erhielt, daß der gute Sänger und vorbildliche Turner Weinheber in den diesbezüglichen Fächern gleichfalls einen „Dreier“ bekam. Man stutzt zunächst einmal, daß der Siebenjährige, der schon 1898 schulpflichtig war, erst 1899 in die Neumayer-Schule in der Kirchstettern-gasse kam, allerdings in die zweite Klasse. Wo hat er die erste absolviert? „Hergesiedelt aus dem Knabenerziehungshaus Sankt-Veit-Gasse, am 1. Dezember 1899“ steht im Klassenbuch. Nun lesen wir wohl in der Biographie, der kleine Weinheber wurde von der Mutter wegen eines kleinen kindlichen Vergehens auf ein paar Wochen, ehe er noch in die Schule ging, nach Ober-Sankt-Veit in eine Anstalt für schwer er-aiehbare Kinder gesteckt. Eine weitere Nachforschung ergab, daß es sich bei dieser Anstalt um den „Wiener Schutzverein zur Rettung verwahrloster Kinder“ handelte, der eine zweiklassige Volksschule führte. Dort war der kleine Peperl Abc-Schütze, aber das Abc hieß: mehr Prügel als Essen. Fern jeder Nestwärme verbrachte Weinheber nicht ein paar Wochen, sondern wohl an die eineinhalb Jahre — zumindest die erste Klasse und drei Monate der zweiten — in dieser Korrektionsanstalt.
Wir lesen in der Biographie: „Als der Vater heimkam und davon hörte, bat er seinen Schwager, Emst Trbuschek, den Knaben wieder heimzuholen. Der fuhr nach Ober-Sankt-Veit und brachte den Buben wieder zurück.“ Man fragt sich, woher kam der Vater heim? Da plaudert wieder das Klassenbuch. Statt des Vaters finden wir als Ziehvater Ernst Trbuschek, den Gastwirt, bei dem Vater Weinheber „kellnerierte“, ehe er Geschäftsführer wurde. Über diese Zeit sagte der Dichter später: „Da war die Gasse meine Heimat und das Wirtshaus meine Lust!“ Und weiter verraten die Ausweise: „Die Mutter, mit dem Beruf Hebamme, wohnte vorerst in der Haberlgasse 48, 1. Stock, Tür 7, und ab 1900 Haberlgasse 49, 1. Stock, Tür 11.“ Als das Ehepaar 1894 von Wien fortzog, hatte es Haberlgasse Nr. 37 gewohnt. Das war also in Ottakring, unweit der Kirchstettern-gasse, wo das Gasthaus Trbuschek stand, und schräg gegenüber die Neumayer-Schule, in die übrigens gleichzeitig mit Josef Weinheber auch der spätere Bundespräsident Dr. Schärf ging.
Nach der Besserungsanstalt das Waisenhaus
Entnehmen wir der Biographie Weinhebers, daß der Vater seine Familie ab 1897 — nach der Rückkehr aus Purkersdorf — im Gasthaus Trbuschek unterbrachte, so stimmt das also nicht. Wo die Mutter mit den Kindern wohnte, wissen wir dokumentarisch aus den Klassenbüchern. Sie wohnte sicherlich nur in Untermiete, denn im Adreßbuch steht sie nicht. Wo aber wohnte der Vater zu dieser Zeit? Ein Blick in das Einwohnerverzeichnis Wiens belehrt uns, daß der fröhliche Johann Gustav Weinheber, Gasthausgeschäftsführer, im Jahr 1897 seine eigene Wohnung im 12. Bezirk, Aichholzgasse 3, hatte, wo er kaum ganz allein gehaust haben dürfte, und 1898 in der Meidlinger Hauptstraße 32. Das gibt uns freilich ganz neue Blickpunkte: Das erklärt die Bitternis der alleingelassenen Mutter, ihre maßlose Strenge und wohl auch Ungerechtigkeit gegen den Buben, der praktisch vaterlos war, umherstrawanzte und Lausbufoen-streiche anstellte. Nun wissen wir aber auch wohl, was die Schwindsucht der Mutter so sehr beschleunigte, daß sie, kaum 36jährig, starb.
Flüsse weisen das Phänomen der Selbstreinigung auf: Das schmutzige Wasser wird nach einer gewissen