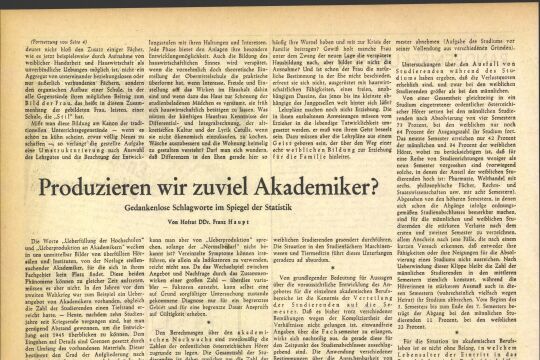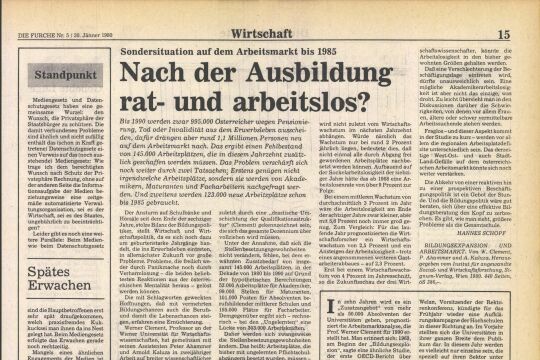Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Phantom mit Absicht?
„Mit Zahlen läßt sich trefflich streiten ...“, möchte man das Dichterwort abwandeln. Oder: „...wo Begriffe fehlen, da stellt die Zahl zur rechten Zeit sich ein.“
Wo man nicht in der Lage ist, Probleme qualitativ auszuloten, da preßt man sie quantitativ in Zahlen. Ob bei Meinungsumfragen, ob an Hochschulen.
Vor zwölf Jahren gab Unterrichtsminister Piffl den Anstoß, eine Verlaufstatistik an Österreichs Universitäten anzulegen, um damit endlich klare Daten für die Hochschulplanung zu erhalten. Man empörte sich damals über die „Schnüffelakten“, die angelegt werden sollten, füttert aber trotzdem seither den Computer mit Zahlen. Das heißt aber noch nicht, daß heute eindeutige Unterlagen über das Universitätsleben zu erhalten wären.
Immer wieder wird bei Debatten in der Öffentlichkeit, auch von Leuten, die sich sehr wohl auskennen müßten, mit Phantomwerten argumentiert.
Erstmals wurde im Wintersemester 1978/79 die Reizschwelle der 100.000 ordentlichen Hörer an Österreichs wissenschaftlichen und Kunst-Hochschulen überschritten - aber der Statistiker des Wissenschaftsministeriums bestätigt im Club 2 (was ohnehin alle Kundigen wissen), daß 30 Prozent von ihnen „gar keine Studenten“ seien.
Aber alle 100.000 sind bei den kommenden Hochschülerschaftswahlen wahlberechtigt - und ihre Gesamtzahl ist maßgeblich für die Zahl der Mandate im Zentralausschuß. Und wenn dann die Wahlbeteiligung nicht viel über 30 Prozent liegt, kann man um so leichter über das politische Desinteresse der Studenten klagen und die Repräsentati-vität der Studentenvertretung in Frage stellen.
Oder ein anderes Phantom, das sein Wesen treibt: Nur .jeder zweite Student“ käme zum Abschluß, man-cherorts betrüge die „drop-out“-Rate sogar 70 Prozent.
Was soll damit bewiesen werden? Daß Österreichs Professoren so viele arme Studentlein hinausprüften, um die Konkurrenz klein zu halten? Wenn von den knapp 800 Erstinskri-benten des Herbstes 1977 an der Wirtschaftsuniversität ein Jahr später rund 250 verschwunden waren, ohne auch nur zu einer Prüfung angetreten zu sein, kann das wohl nicht der Grund sein.
Frau Minister Firnberg hat oft genug betont, daß die Entscheidung über das weitere Studium in der ersten Phase fallen müsse, wenn man Methoden wie den numerus clausus vermeiden wolle. Alle diese Versicherungen haben nicht verhindert, daß nach wie vor mit „50 Prozent drop out“ operiert wird. Auch und gerade von Leuten, die durchaus wissen müßten, wie sich die Dinge verhalten.
Die Ursachen für die Grauzonen in der Hochschulstatistik liegen nur zum geringsten Teil in den Universitäten selbst. Sie abzustellen, wäre Aufgabe der Aufsichtsbehörde. Im Zeitalter des Computers mit Phantomzahlen zu operieren, läßt entweder auf Unfähigkeit schließen oder ein weiteres Dichterwort erahnen: „Man merkt die Absicht, und man ist verstimmt.“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!