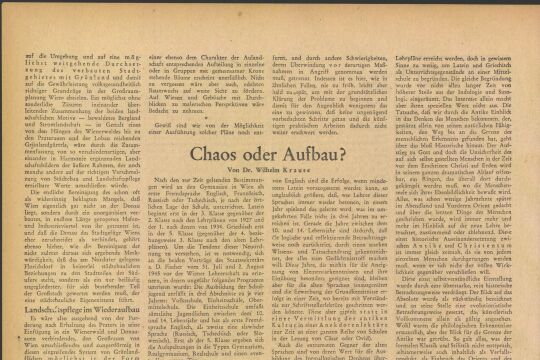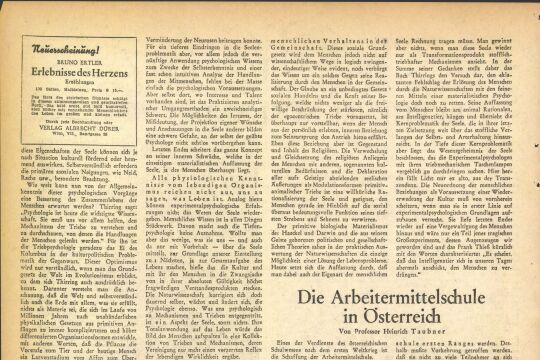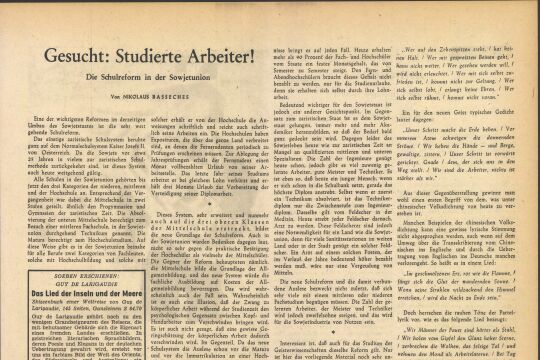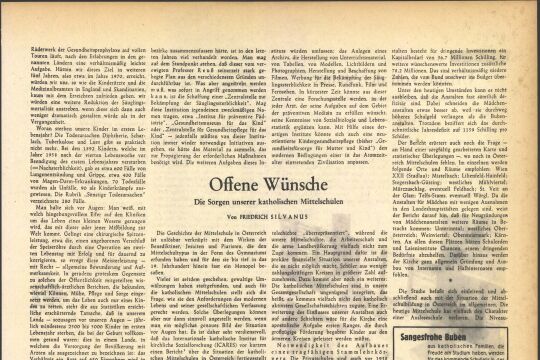Kaum eine andere Prüfung erregt so viel öffentliche Aufmerksamkeit wie die Matura. In Österreich ist fast jedem Friedrich Torbergs "Schüler Gerber" geläufig, der aus Angst vor den Maturaergebnissen sogar aus dem Fenster springt. Gruselgeschichten von boshaften Prüfungen, unlösbaren Aufgaben und Gefälligkeitsnoten gibt es zuhauf. In knapp drei Wochen soll dieses alte Prüfungsregime jedoch Geschichte sein: Erstmals werden die Schülerinnen und Schüler zur "Zentralmatura" antreten, die sich offiziell "standardisierte kompetenzorientierte Reifeprüfung" nennt. Als Vorbild muss das Ausland herhalten - wie so oft in der österreichischen Bildungsgeschichte. Schon die Einführung der Maturitätsprüfung an den Gymnasien 1850 beruhte auf Nachahmung ausländischer Beispiele. Preußen hatte etwa bereits 1788 erste Schritte in diese Richtung unternommen. Es folgten entsprechende Umstellungen in Lehrerbildung und Lehrplan, ehe die Reifeprüfung 1832 Aufnahmevoraussetzung für die Universitäten wurde. Ähnlich waren Bayern (ab 1809) und Sachsen (ab 1829) vorgegangen.
Weniger Latein, doppelt so viel Mathematik
In Österreich sollte dies zwar verspätet, aber umso schneller nachgeholt werden: Einem ersten Organisationsplan für das neue Gymnasium von 1849 folgte schon ein Jahr später die verbindliche Einführung der Reifeprüfung. Dafür wurden die bis dahin üblichen, auf bestimmte Fakultäten der Universität vorbereitenden philosophischen Kurse aufgelassen und das Gymnasium von sechs auf acht Jahre verlängert. Damit einher ging eine weitreichende Umschichtung im Lehrplan: Weniger Latein, fast eine Verdoppelung der Stunden für Mathematik sowie für Geografie und Geschichte, zusätzlich ein umfangreicher Block mit Naturgeschichte und Physik. Auch die universitäre Lehrerbildung wurde dem neuen System umgehend angepasst.
Die Reifeprüfung war in allen Pflichtgegenständen (außer philosophische Propädeutik) abzulegen. Dahinter steckte die gleiche Idee wie 1788 in Preußen: Es ging nicht darum, was in diesem oder jenem Fach genau beherrscht wurde, sondern darum, ob dem Schüler allgemein die für wissenschaftliche Studien erforderliche Reifung (lat. maturitas - Reife, Vollendung) in Können und Verhalten bescheinigt werden konnte. Deshalb sollten die Fragestellungen für die Matura lokal entwickelt werden, ja es wurde ausdrücklich verboten, Unterrichtsinhalte zu prüfen, "welche im Unterricht noch nicht vorgekommen waren". Für die Gymnasiallehrer bedeutete diese Umstellung eine nachhaltige Aufwertung ihrer gesellschaftlichen Rolle.
Wie studierfähig ist der Nachwuchs?
An dieser Grundstruktur hat sich in den folgenden 150 Jahren wenig geändert, obwohl Umfang und Anspruch des neuen Formats von Anfang an umstritten waren. Bis heute klagen die Universitäten über die mangelnde Studierfähigkeit des Nachwuchses, den sie nicht mehr selber aussuchen dürfen. Ebenso melden sich periodisch Stimmen aus Wirtschaft und Gesellschaft, die den Niedergang oder die Lebensferne der Matura beklagen. Das führte immer wieder zu begrenzten Anpassungen der Prüfungsfächer oder der Prüfungsanforderungen.
Nach und nach weitete sich zudem der Kreis derjenigen aus, die eine Matura ablegen durften: von der Einführung eines Realabschlusses mit Matura (ab 1869) über die Zulassung der Mädchen (ab 1872), die Einführung der BHS (seit 1962) bis hin zu diversen Formen, außerschulisch Studienberechtigungen zu erwerben (seit 1945). Waren es anfangs pro Jahr einige Dutzend Schüler im ganzen Kaiserreich, die sich der Reifeprüfung stellten, so waren es 1960 schon rund 11.000 und 2013 bereits 44.000 Schülerinnen und Schüler, also gut zwei Fünftel der Alterskohorte. Mädchen stellen jetzt 56 Prozent der Prüflinge. Gut 60 Prozent aller Reifeprüfungen werden heutzutage an berufsbildenden Schulen absolviert, und mehr als 40 Prozent aller Maturantinnen und Maturanten haben in der Pflichtschulzeit noch die Hauptschule besucht. Für die Studienvorbereitung scheint diese Ausweitung kein Nachteil zu sein: AHS-Absolventen sind im Durchschnitt an Universitäten und Hochschulen nicht erfolgreicher.
Formal versprach die Einführung der Matura von Anfang an Gleichheit: Prüfungen, nicht Standesunterschiede sollten über den Zugang zur Universität entscheiden. Doch trotz aller Ausweitungen sind auch heute noch die Chancen der Kinder aus unteren Schichten, irgendeine Studienberechtigung zu erreichen, weitaus schlechter als jene von Kindern aus höheren Kreisen. Wenn zudem bald die Hälfte jedes Jahrgangs die Matura schafft, löst das auch Fragen nach deren Qualität und Vergleichbarkeit aus.
Die gegenwärtige Antwort darauf ist die Einführung einer teilzentralen Reifeprüfung, bei deren schriftlichem Teil Aufgaben und Bewertungsparameter einheitlich vom Bund vorgegeben werden. Bislang hat das zu einer nicht enden wollenden Pannenserie geführt. Sollte es aber gelingen, die Zentralmatura einwandfrei durchzuführen, wird dann wirklich alles besser?
Wahrscheinlich ist dies nicht. Zentralisierte Prüfungssysteme schaffen in aller Regel weder mehr soziale Gerechtigkeit noch nachhaltige Leistungssteigerungen. Im Gegenteil: Sie sind meist begleitet von wachsenden Unterschieden, Schrumpfen der Lehrplaninhalte und zunehmender Bedeutung privater Bildungsinvestitionen (wenig überraschend konnte man auch Vorbereitungskurse auf die neue Matura kaufen). Allenfalls ersetzen sie lokale Ungerechtigkeiten durch flächendeckende Benachteiligung jener, die nicht das Glück hatten, zufällig genau die prüfungsrelevanten Einzelheiten durchgenommen zu haben. Bei der Vielfalt des Möglichen kann niemand garantieren, dass das überall gleichermaßen geschieht. Mehr noch: Durch die Entkoppelung der Prüfungen vom vorhergegangenen Unterricht könnte man die Studienberechtigung bald vollends vom Schulbetrieb lösen oder den Hochschulen überlassen, die dann wieder fachspezifische Anforderungen stellen können (wie es in einigen Fächern wie Medizin bereits geschieht). Die Matura hört in jedem Falle auf, eine Feststellung der allgemeinen Studierfähigkeit zu sein.
Stärkere soziale Unterschiede
Wem nutzt das? Viele Lehrkräfte scheinen Umfrageergebnissen zufolge sogar erleichtert zu sein, dass ihnen die Last einer selbständigen Bewertung von den Schultern genommen wird, auch wenn sie das zu Erfüllungsgehilfen eines ferngesteuerten Prüfungsbetriebs degradiert. Vermutlich wird es in den ersten Jahren leicht verbesserte Durchschnittswerte geben, weil sich die Beteiligten an die neuen minimalistischen Aufgabenformate gewöhnen, was die Politik als Erfolg anpreisen wird. Die Forschung wird dann -wie schon in anderen Ländern - zeigen, dass allfällige geringe Leistungsgewinne in einzelnen Prüfungsbereichen mit Verlusten in anderen Lernbereichen bezahlt wurden und sich soziale Unterschiede wieder stärker Geltung verschaffen. Im Ergebnis wird sich dann in einigen Jahren abspielen, was ebenso typisch für österreichische Bildungspolitik ist: Wie so oft wird niemand die Verantwortung für die Flurschäden einer Reform übernehmen, die eine sicher nicht problemfreie Tradition gründlich zerstört, ohne an deren Stelle etwas zweifelsfrei Besseres setzen zu können.
Mitarbeit: Bernhard Hemetsberger
| Der Autor ist Professor für historische und vergleichende Schul-und Bildungsforschung an der Universität Wien |
Weltwissen der Achtzehnjährigen
In Kürze feiert die "standardisierte kompetenzorientierte Reifeprüfung" Premiere. Doch wie reif ist die Zentralmatura selbst? Und was sollen 18-Jährige überhaupt wissen, können und erlebt haben? Donata Elschenbroich hat 2001 im Klassiker "Weltwissen der Siebenjährigen" einen Kanon für Schulanfänger präsentiert, die FURCHE fragt nach dem wünschenswerten Horizont von Maturantinnen und Maturanten.
Redaktion: Doris Helmberger
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!