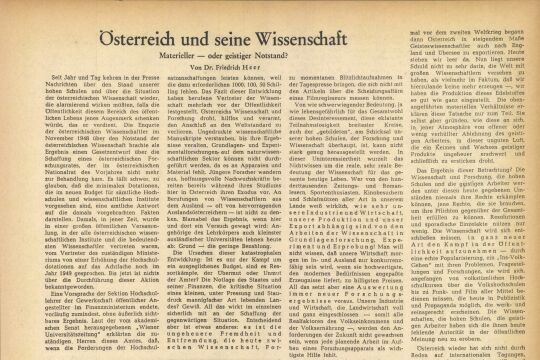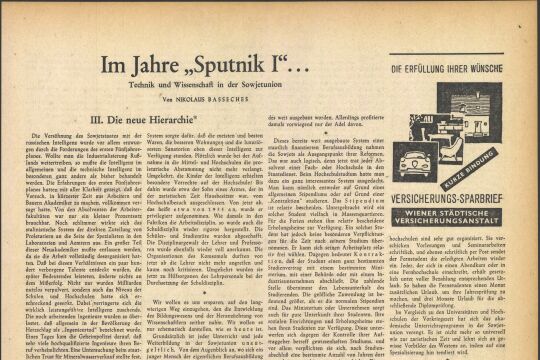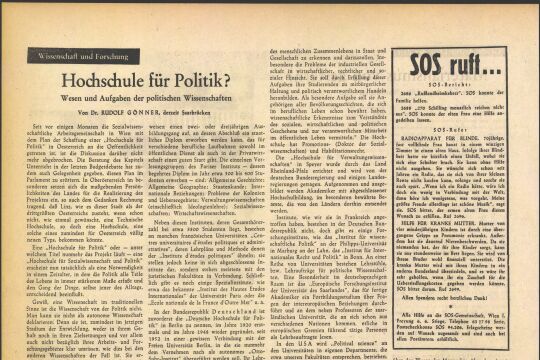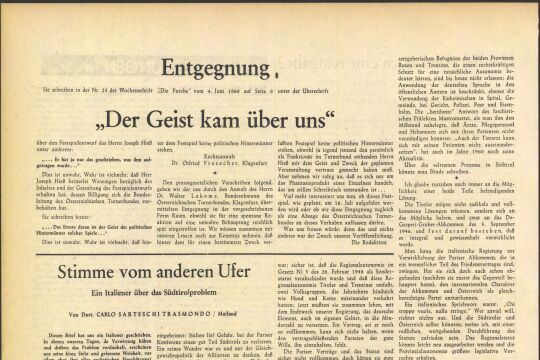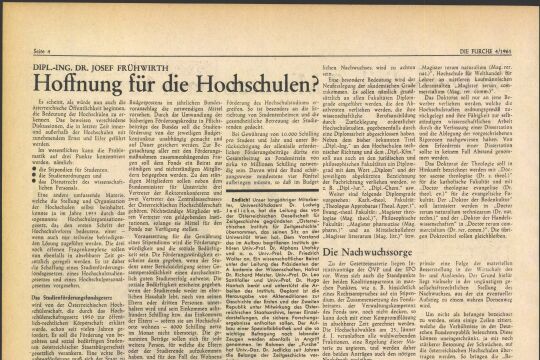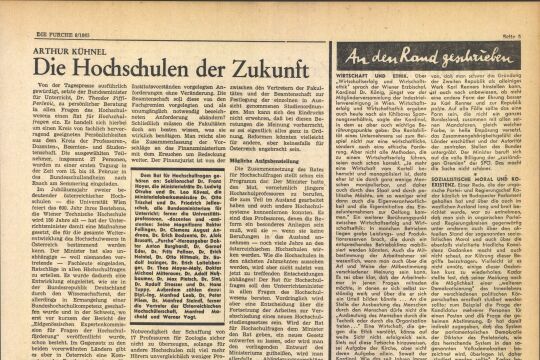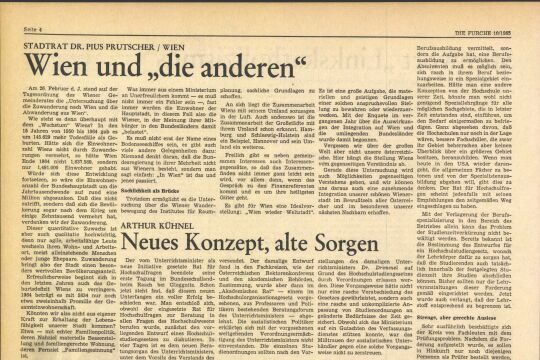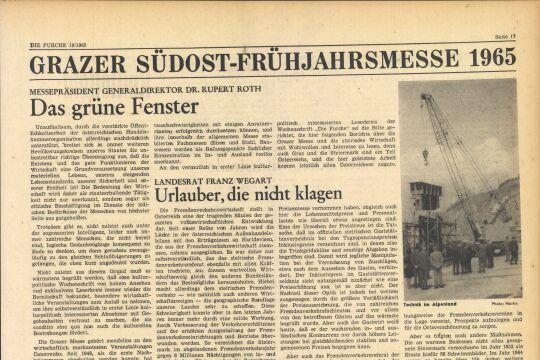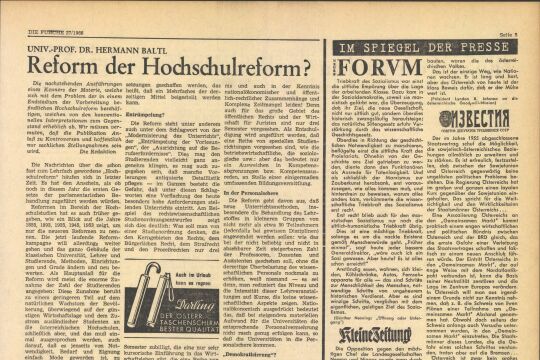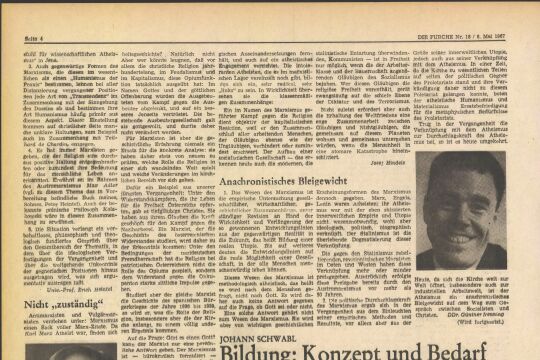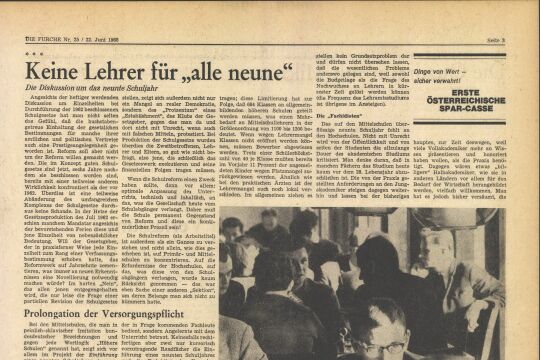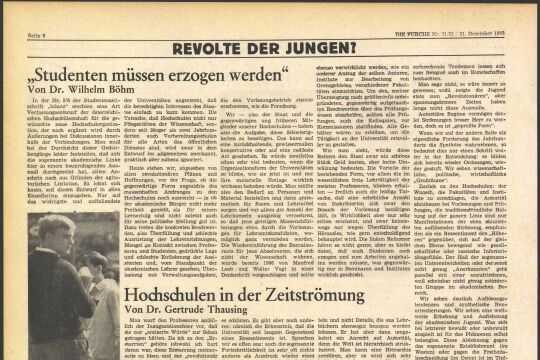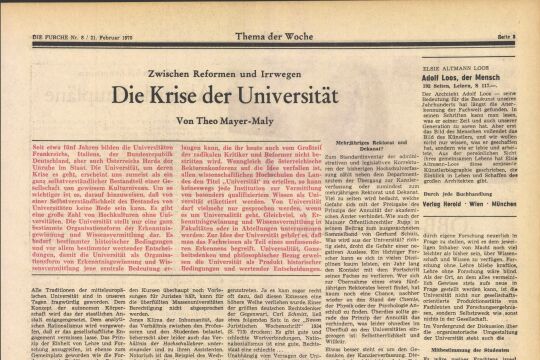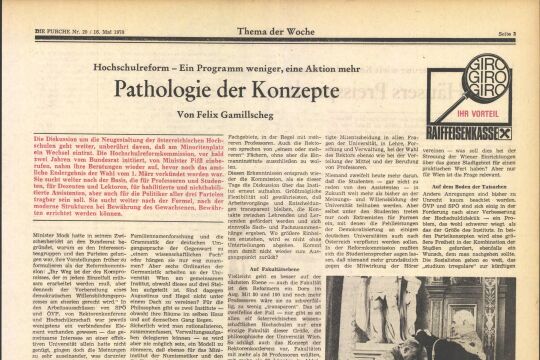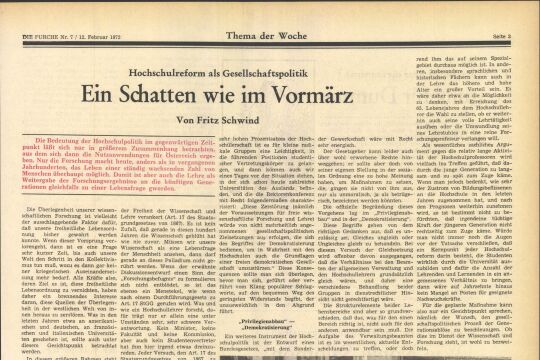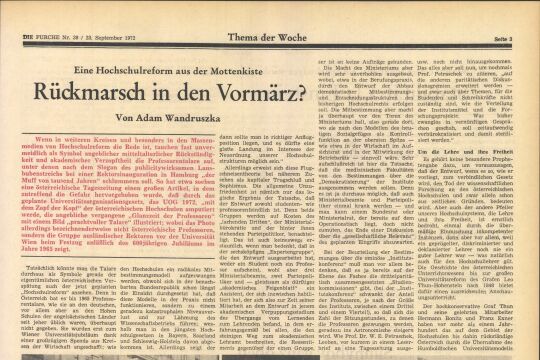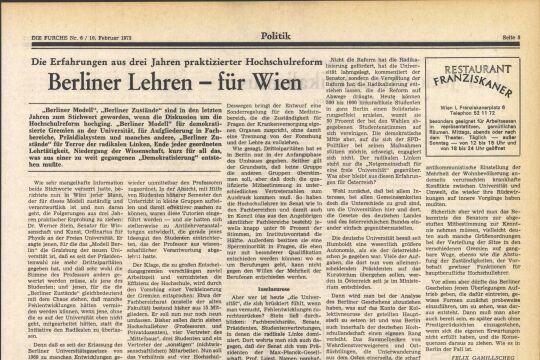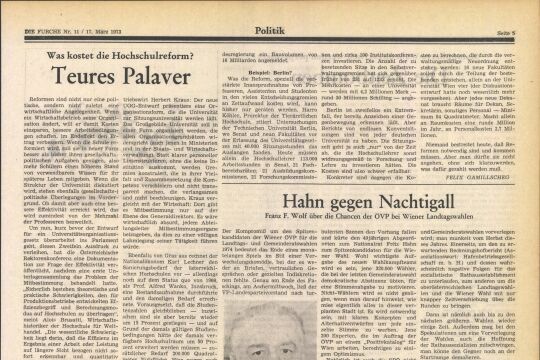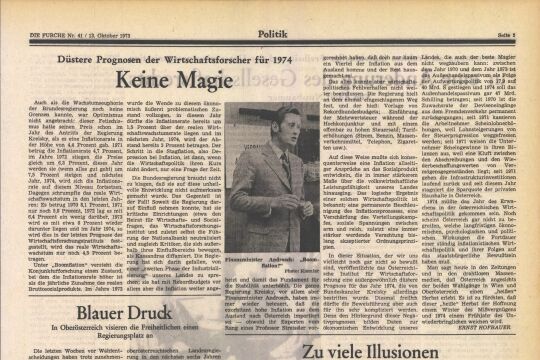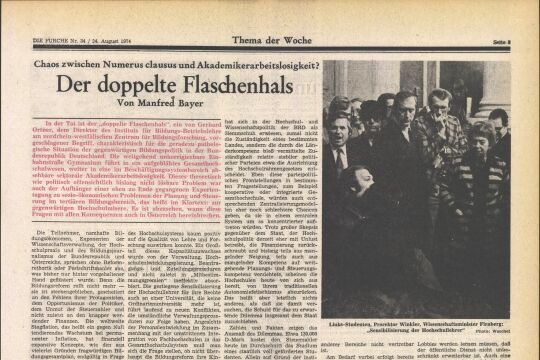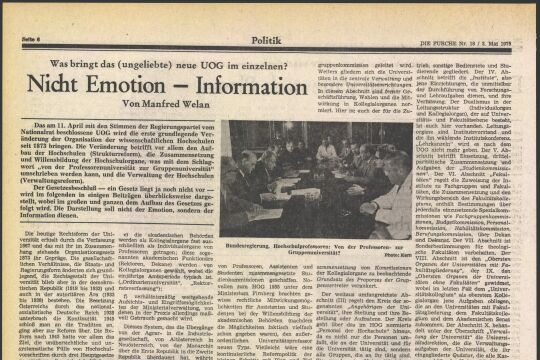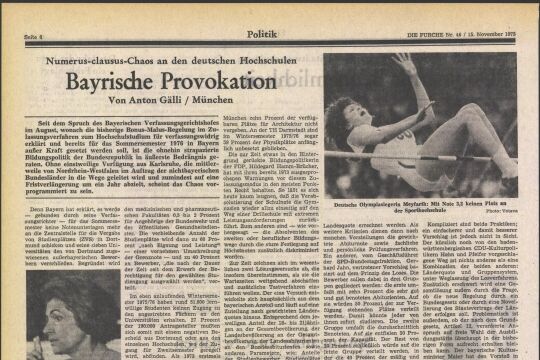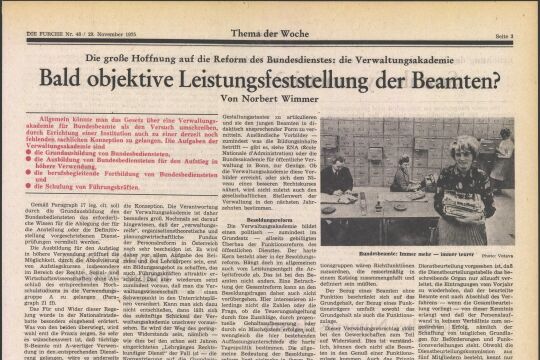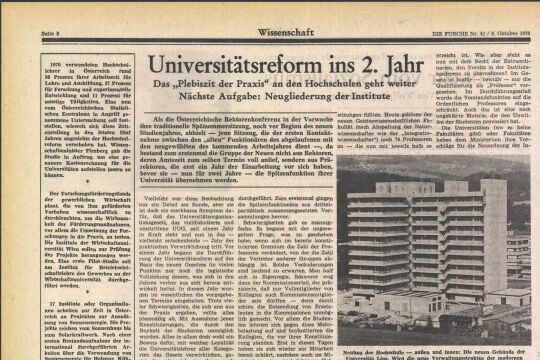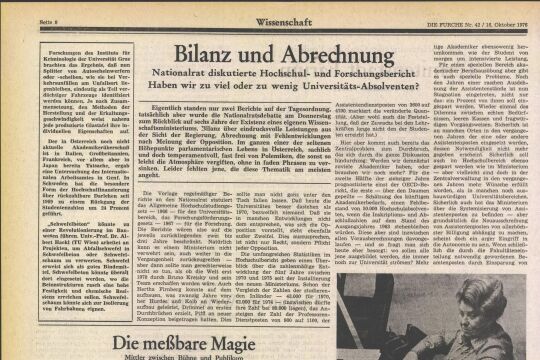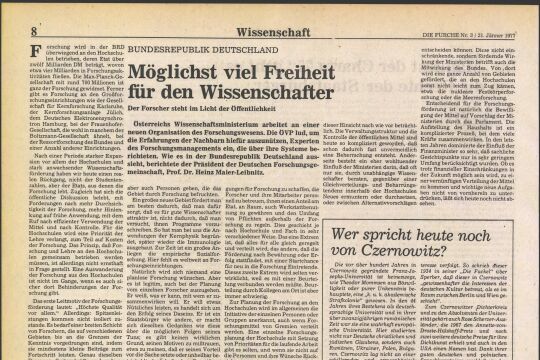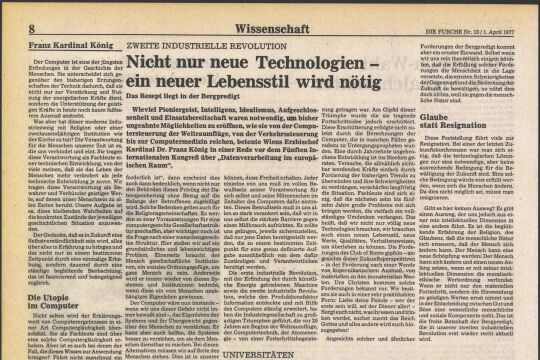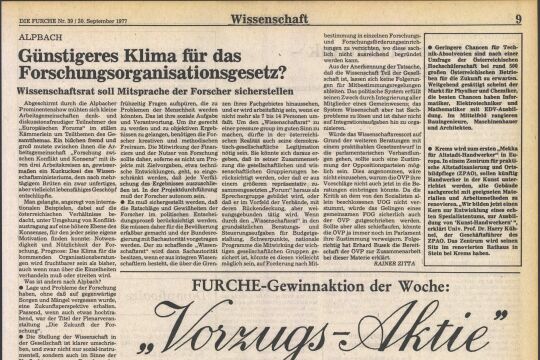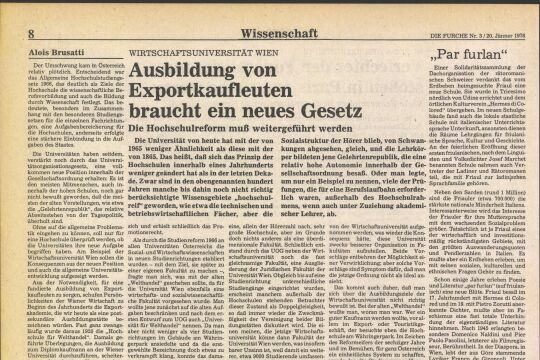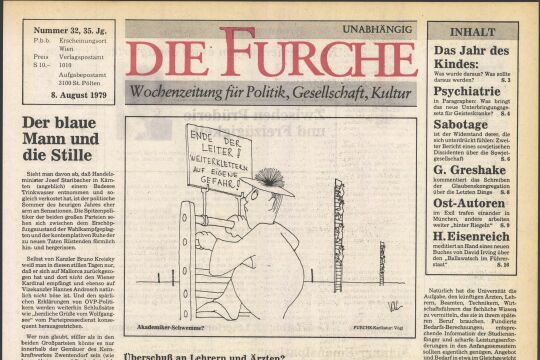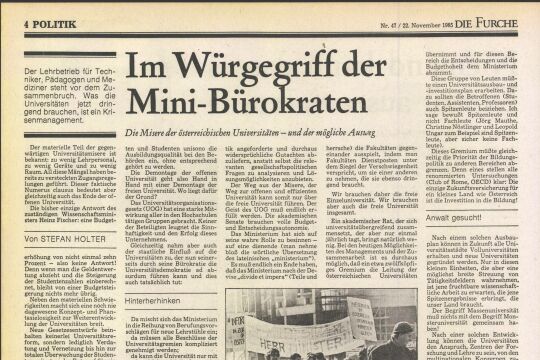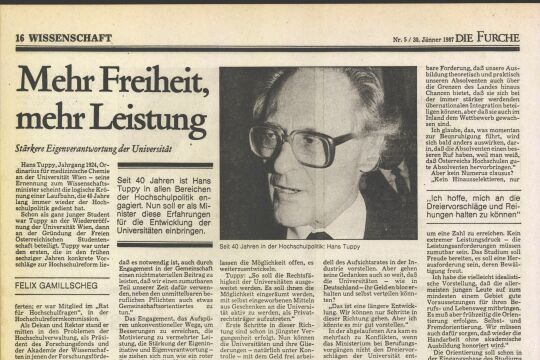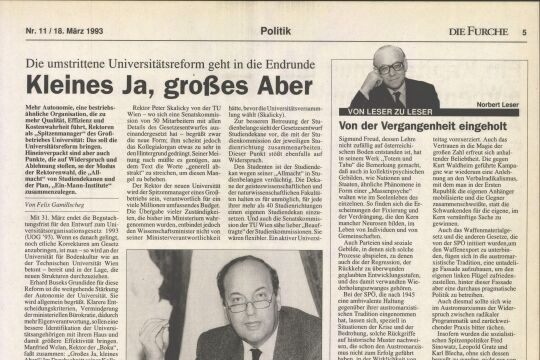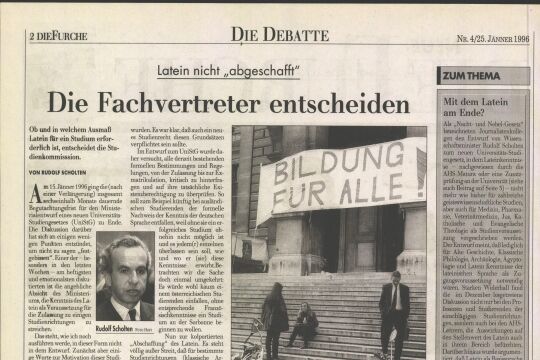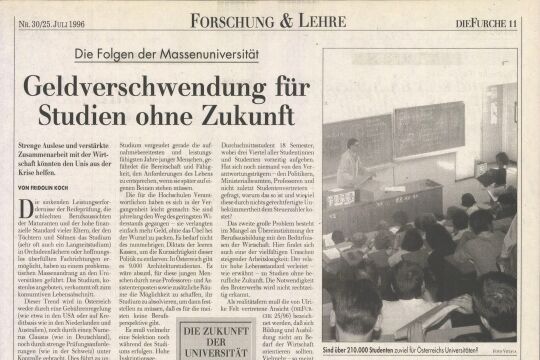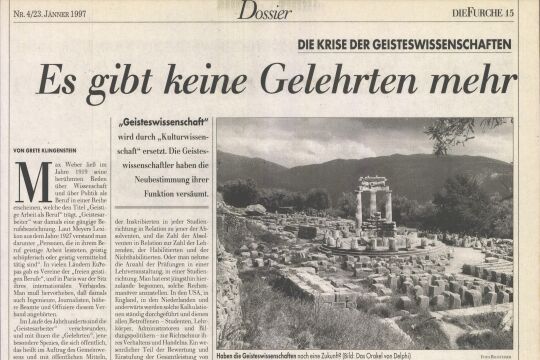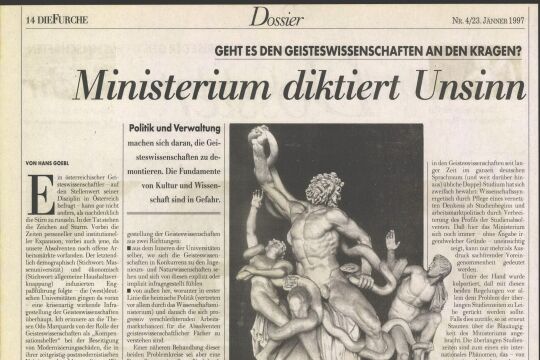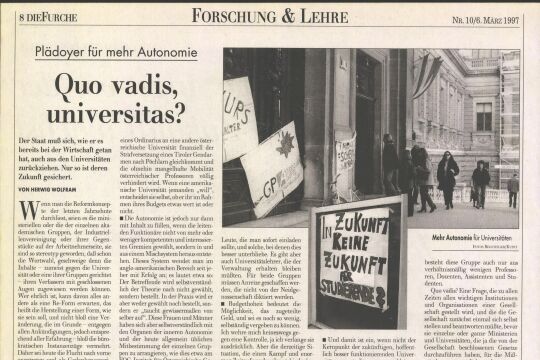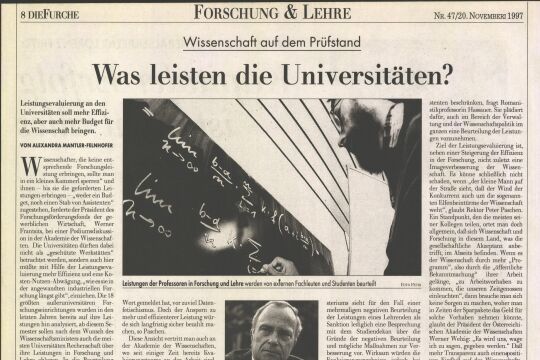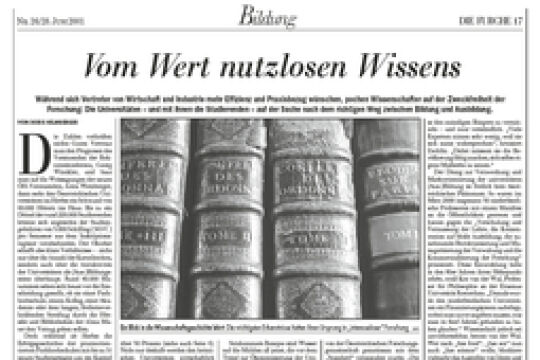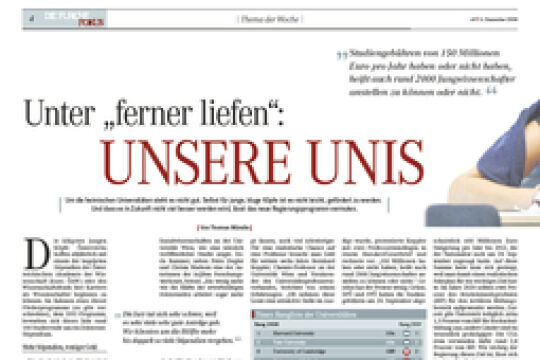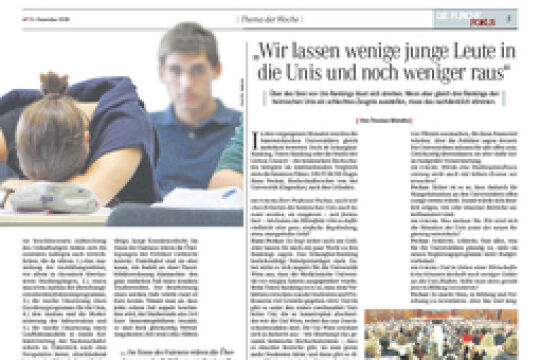Uni im Ausverkauf?
FOKUS
Universitäten: Im Dschungel der Interessen
An den Hochschulen zeigen sich Glanz und Elend des „New Public Management“. Was ein Gesetz über das aktuelle Verhältnis von Universität, Politik und Gesellschaft erzählt.
An den Hochschulen zeigen sich Glanz und Elend des „New Public Management“. Was ein Gesetz über das aktuelle Verhältnis von Universität, Politik und Gesellschaft erzählt.
Kennen Sie den GUEP? Wissen Sie, was im 109er steht? Vermutlich nicht. Dabei handelt es sich um zwei der signifikanteren Blüten, die aus dem Universitätsgesetz von 2002 (kurz UG02) resultieren. Mit diesem Gesetz sind vor 21 Jahren die Verhältnisse an den Universitäten ganz neu geordnet worden. Das UG02 feierte letztes Jahr sein rundes Jubiläum. Bewegt hat das nur wenige – erstaunlich, wenn man sich an die Kontroversen erinnert, die es rund um seine Einführung gab. Das neue Gesetz brachte den europäischen Zeitgeist des „New Public Management“ in die Universitäten – und passte auch ideologisch zur rechtskonservativen Koalition zwischen FPÖ und ÖVP. Versprochen wurde, das leidliche „Governance“-Problem zu lösen (also die Lenkung der Unis), den wissenschaftlichen Output zu erhöhen und Studierende verlässlicher und schneller zum Abschluss zu bringen.
Legitimation, Exzellenz, Professionalisierung: Konnten diese Versprechen gehalten werden? Klar ist: Gegenüber dem damals bestehenden System gab es sowohl im Ministerium als auch an den Universitäten Bedenken. So wurde etwa bezüglich „Governance“ die Schwerfälligkeit der Universitätsgremien kritisiert und auch, dass das Ministerium jede Entscheidung bestätigen musste. Und bezüglich der wissenschaft-lichen Outputs herrschte die Wahrnehmung, dass zu viel Mittelmaß in unkündbare Positionen gekommen war. Zudem gab es noch eine Reihe weiterer Themen, etwa die Finanzierung oder die Studienabschlüsse.
Dynamisierter Arbeitsmarkt
Das UG02 räumte bei der Lenkung ordentlich auf: Die Unis sind nun – man muss das Juristendeutsch lieben – „vollrechtsfähig“. Der Rektor ist der CEO der Universität, der nach unten freie Hand haben soll und nach oben durch Leistungsvereinbarungen gesteuert wird, die auf messbaren Zielen beruhen. Freilich: Eine öffentliche Universität wird in Österreich zum allergrößten Teil aus Steuergeldern finanziert. Der Legitimationsbedarf ist also anders gelagert als bei einem, sagen wir mal, börsennotierten Unternehmen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!