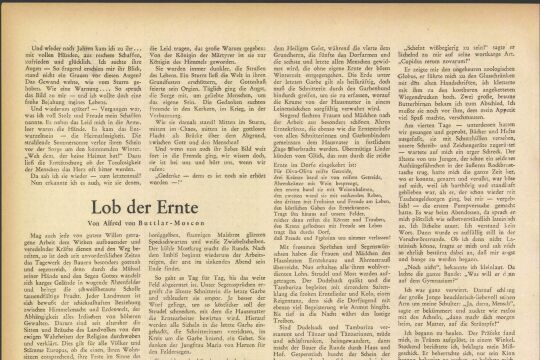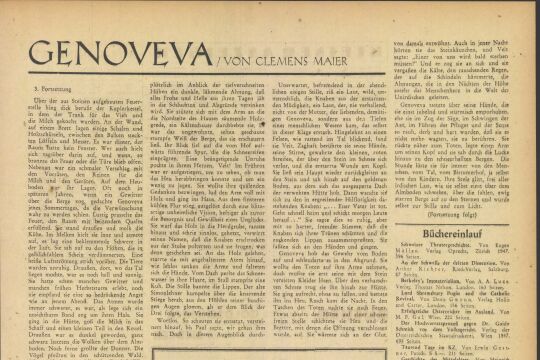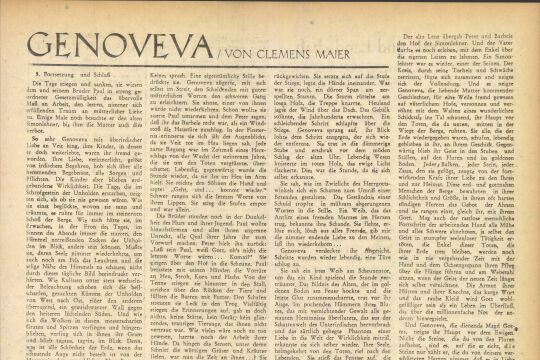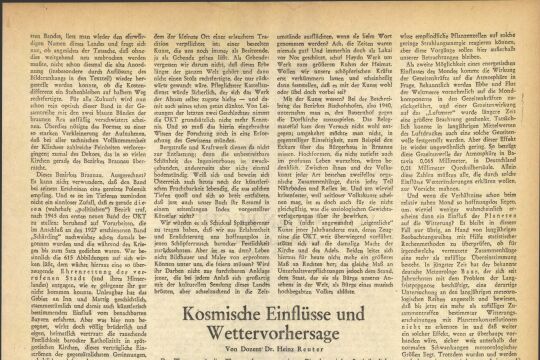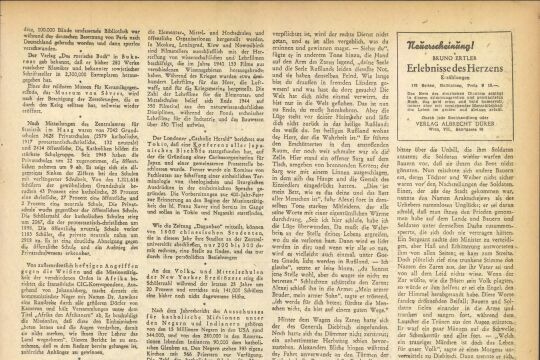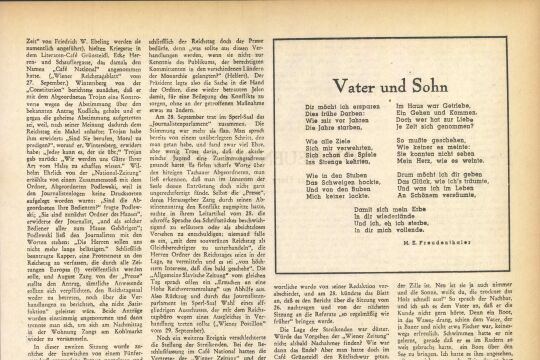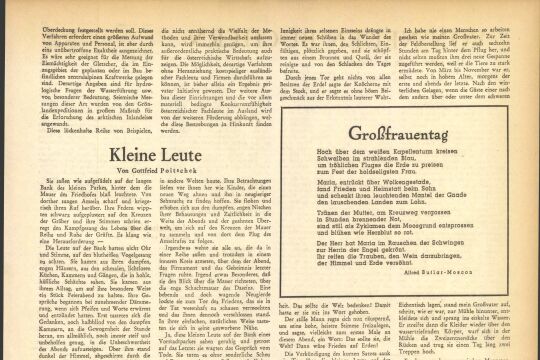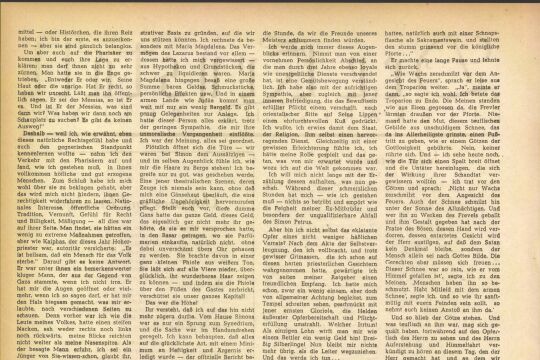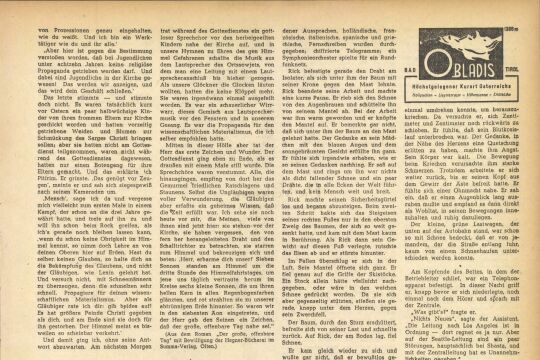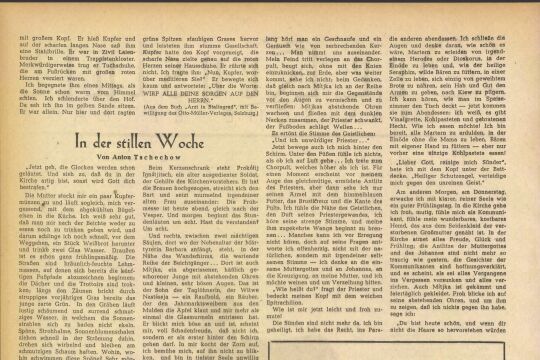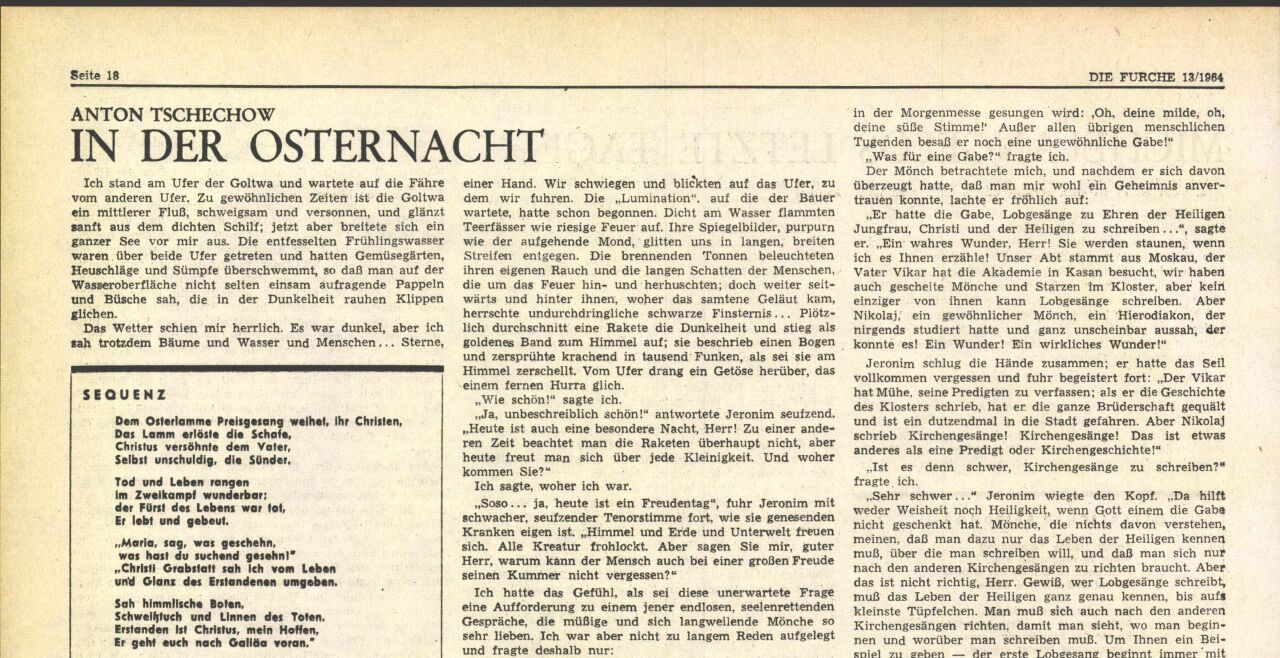
Ich stand am Ufer der Goltwa und wartete auf die Fähre vom anderen Ufer. Zu gewöhnlichen Zeiten ist die Goltwa ein mittlerer Fluß, schweigsam und versonnen, und glänzt sanft aus dem dichten Schilf; jetzt aber breitete sich ein ganzer See vor mir aus. Die entfesselten Frühlingswasser waren über beide Ufer getreten und hatten Gemüsegärten, Heuschläge und Sümpfe überschwemmt, so daß man auf der Wasseroberfläche nicht selten einsam aufragende Pappeln und Büsche sah, die in der Dunkelheit rauhen Klippen glichen.
Das Wetter schien mir herrlich. Es war dunkel, aber ich sah trotzdem Bäume und Wasser und Menschen... Sterne,
die den ganzen Himmel übersäten, erhellten die Welt Ich kann mich nicht entsinnen, zu einer anderen Zeit je so viele Sterne gesehen zu haben. Es war buchstäblich nirgends ein freier Platz, wo man den Finger hätte hineinstoßen können. Dort oben waren Sterne, groß wie ein Gänseei, und andere klein wie Hanfkörner... Zur feiertäglichen Parade standen sie alle bis auf den letzten am Himmel, vom kleinsten bis zum größten, gewaschen, erneuert, freudig, und alle sandten sie sanfte, blinkende Strahlen aus. Der Himmel spiegelte sich im Wasser, die Sterne badeten in der dunklen Tiefe und bebten zusammen mit den leise schaukelnden Wellen. Die Luft war warm und still. Fern, am anderen Ufer, brannten einige grellrote Feuer in der undurchdringlichen Finsternis...
Zwei Schritte von mir entfernt sah ich die dunkle Silhouette eines Baue'rn mit einer hohen Mütze und einem dicken Knotenstoek.
„Wie lange die Fähre auf sich warten läßt!“ sagte ich zu ihm.
„Ja, sie müßte schon längst hier sein“, antwortete die Silhouette.
„Wartest du auch auf die Fähre?“
„Nein, ich stehe nur so hier“, gähnte der Bauer, „ich warte auf die Lumination. Ich würde schon hinüberfahren, aber ich habe keinen Fünfer für die Fähre.“
„Ich gebe dir einen Fünfer.“
„Nein, ich danke ergebenst... Stell für diesen Fünfer lieber im Kloster eine Kerze für mich auf... Das wird besser sein, und ich kann ja auch hier bleiben. Nein so was, die Fähre ist immer noch nicht da! Als wäre sie untergegangen.“
Der Bauer ging dicht ans Wasser heran, packte das Seil und schrie:
„Jeronim! Jeron-i-im!“
Gleichsam als Antwort auf seinen Ruf hallte der langgezogene Ton einer großen Glocke vom anderen Ufer herüber. Der Klang war tief und sonor wie von der dicksten Saite einer Baßgeige: die Dunkelheit selber schien mit rauher Stimme zu singen. Gleich darauf hörte man einen Kanonenschuß. Er rollte durch die Finsternis und verhallte irgendwo weit hinter meinem Rücken. Der Bauer nahm den Hut ab und bekreuzigte sich:
„Der Herr ist auferstanden!“ sagte er.
Die Wogen des ersten Glockenschlags waren noch nicht verebbt, als ein zweiter, ein dritter erklang, und die Dunkelheit füllte sich mit einem ununterbrochenen Dröhnen. Neben den roten Feuern flammten neue Feuer auf, und alle zusammen kamen in Bewegung und flackerten unruhig.
„Jeron-i-im!“ erklang ein dumpfer, ■ langgezogener Ruf.
„Sie rufen vom anderen Ufer“, sagte der Bauer, „also ist die Fähre auch dort nicht. Unser Jeronim wird eingeschlafen sein.“
Die Feuer und der samtene Glockenton lockten mich hinüber ... Ich begann schon die Geduld zu verlieren und mich aufzuregen, doch als ich in die dunkle Ferne spähte, erblickte ich endlich eine Silhouette, die große Ähnlichkeit mit einem Galgen hatte. Das war die lang erwartete Fähre. Sie bewegte sich mit einer solchen Langsamkeit, daß man, wären ihre Umrisse nicht immer klarer hervorgetreten, hätte denken können, sie stehe still oder gleite zum anderen Ufer hinüber.
„Schneller! Jeronim!“ schrie mein Bauer. „Ein Herr wartet!“
Die Fähre kroch ans Ufer, schwankte und hielt knarrend an. Darauf stand ein hochgewachsener Mann in einer Mönchskutte und mit einer kegelförmigen Mütze; er hielt sich am Seil fest.
„Warum hat es so lange gedauert?“ fragte ich, auf die Fähre springend.
„Verzeihen Sie mir um Christi willen“, antwortete Jeronim leise. „Niemand mehr da?“
„Niemand...“
Jeronim faßte mit beiden Händen das Seil, krümmte sich zu einem Fragezeichen zusammen und ächzte. Die Fähre knarrte und schaukelte. Die Silhouette des Bauern im hohen Hut begann sich langsam zu entfernen, also schwamm die Fähre. Jeronim richtete sich bald auf und arbeitete mit
einer Hand. Wir schwiegen und blickten auf das Ufer, zu dem wir fuhren. Die „Lumination“. auf die der Bauer wartete, hatte schon begonnen. Dicht am Wasser flammten Teerfässer wie riesige Feuer auf. Ihre Spiegelbilder, purpurn wie der aufgehende Mond, glitten uns in langen, breiten Streifen entgegen. Die brennenden Tonnen beleuchteten ihren eigenen Rauch und die langen Schatten der Menschen, die um das Feuer hin- und herhuschten; doch weiter seitwärts und hinter ihnen, woher das samtene Geläut kam, herrschte undurchdringliche schwarze Finsternis ... Plötzlich durchschnitt eine Rakete die Dunkelheit und stieg als goldenes Band zum Himmel auf; sie beschrieb einen Bogen und zersprühte krachend in tausend Funken, als sei sie am Himmel zerschellt. Vom Ufer drang ein Getöse herüber, das einem fernen Hurra glich. „Wie schön!“ sagte ich.
„Ja, unbeschreiblich schön!“ antwortete Jeronim seufzend. „Heute ist auch eine besondere Nacht, Herr! Zu einer anderen Zeit beachtet man die Raketen überhaupt nicht, aber heute freut man sich über jede Kleinigkeit. Und woher kommen Sie?“
Ich sagte, woher ich war.
„Soso... ja, heute ist ein Freudentag“, fuhr Jeronim mit schwacher, seufzender Tenorstimme fort, wie sie genesenden Kranken eigen ist. „Himmel und Erde und Unterwelt freuen sich. Alle Kreatur frohlockt. Aber sagen Sie mir, guter Herr, warum kann der Mensch auch bei einer großen Freude seinen Kummer nicht vergessen?“
Ich hatte das Gefühl, als sei diese unerwartete Frage eine Aufforderung zu einem jener endlosen, seelenrettenden Gespräche, die müßige und sich langweilende Mönche so sehr lieben. Ich war aber nicht zu langem Reden aufgelegt und fragte deshalb nur:
„Was für einen Kummer haben Sie denn, Väterchen?“
„Einen ganz gewöhnlichen, wie alle Menschen, Euer Wohlgeboren, guter Herr. Aber heute ist unserem Kloster ein großes Leid widerfahren; gerade beim Mittagsgottesdienst, als aus der Bibel gelesen wurde, ist der Hierodiakon Nikolaj gestorben...“
„Nun, das ist Gottes Wille!“ sagte ich, den Ton der Mönche nachahmend. „Alle müssen einmal, sterben. Meiner Ansicht nach müßten Sie sich sogar freuen... Man sagt, wer vor Ostern oder an Ostern stirbt, der kommt ganz bestimmt in den Himmel.“
„Das ist richtig.“
Wir verstummten. Die Silhouette des Bauern im hohen Hut verschmolz mit den Umrissen des Ufers. Die Teertonnen loderten immer heller und heller.
„Auch die Heilige Schrift sagt, daß der Schmerz nichtig ist, und auch die Überlegung“, unterbrach Jeronim das Schweigen. „Aber warum grämt sich die Seele und will nicht auf den Verstand hören? Warum möchte man bitterlich weinen?“
Jeronim zuckte die Achseln, wandte sich mir zu und sagte hastig:
„Wäre ich gestorben oder ein anderer, so hätte man es vielleicht gar nicht bemerkt, aber .Nikolaj jst Ja gestorben! Niemand anderer als Nikolai! Ich kann kaum glauben, daß
er nicht mehr auf der Welt ist! Ich stehe da auf der Fähre, und immer ist mir, als müßte ich sogleich seine Stimme am Ufer hören. Er kam immer ans Ufer und rief mir zu, damit es mir auf der Fähre nicht bange wurde. Deswegen ist er nachts vom Bett aufgestanden. So eine gute Seele! Mein Gott, wie gut und barmherzig er war! Manch einer hat nicht an seiner Mutter, was ich an Nikolaj hatte.! Gott schenke ihm die ewige Seligkeit!“
Jeronim griff zu dem Seil, wandte sich aber sogleich wieder zu mir
„Und was für einen hellen Verstand er hatte, Euer Wohlgeboren!“ sagte er mit singender Stimme. „Was für eine wohlklingende und süße Sprache! Genau so, wie jetzt gleich
in der Morgenmesse gesungen wird: ,Oh, deine milde, oh, deine süße Stimme!' Außer allen übrigen menschlichen Tugenden besaß er noch eine ungewöhnliche Gabe!“ „Was für eine Gabe?“ fragte ich.
Der Mönch betrachtete mich, und nachdem er sich davon überzeugt hatte, daß man mir wohl ein Geheimnis anvertrauen konnte, lachte er fröhlich auf:
„Er hatte die Gabe, Lobgesänge zu Ehren der Heiligen Jungfrau, Christi und der Heiligen zu schreiben...“, sagte er. „Ein wahres Wunder, Herr! Sie werden staunen, wenn ich es Ihnen erzähle! Unser Abt stammt aus Moskau, der Vater Vikar hat die Akademie in Kasan besucht, wir haben auch gescheite Mönche und Starzen im Kloster, aber kein einziger von ihnen kann Lobgesänge schreiben. Aber Nikolaj, ein gewöhnlicher Mönch, ein Hierodiakon, der nirgends studiert hatte und ganz unscheinbar aussah, der konnte es! Ein Wunder! Ein wirkliches Wunder!“
Jeronim schlug die Hände zusammen; er hatte das Seil vollkommen vergessen und fuhr begeistert fort: „Der Vikar hat Mühe, seine Predigten zu verfassen; als er die Geschichte des Klosters schrieb, hat er. die ganze Brüderschaft gequält und ist ein dutzendmal in die Stadt gefahren. Aber Nikolaj schrieb Kirchengesänge! Kirchengesänge! Das ist etwas anderes als eine Predigt oder Kirchengeschichte!“
„Ist es denn schwer, Kirchengesänge zu schreiben?“ fragte ich.
„Sehr schwer...“ Jeronim wiegte den Kopf. ,.Da hilft weder Weisheit noch Heiligkeit, wenn Gott einem die Gabe nicht geschenkt hat. Mönche, die nichts davon verstehen, meinen, daß man dazu nur das Leben der Heiligen kennen muß, über die man schreiben will, und daß man sich nur nach den anderen Kirchengesängen zu richten braucht. Aber das ist nicht richtig, Herr. Gewiß, wer Lobgesänge schreibt, muß das Leben der Heiligen ganz genau kennen, bis aufs kleinste Tüpfelchen. Man muß sich auch nach den anderen Kirchengesängen richten, damit man sieht, wo man beginnen und worüber man schreiben muß. Um Ihnen ein Beispiel zu geben — der erste Lobgesang beginnt immer mit .Erwählter' oder .Auserwählter'... Der erste Ikos nach dem Lobgesang fängt immer mit dem Engel an. In dem Gesang zu Ehren Christi beginnt er so: ,Der Engel Schöpfer, Herr der Kraft', in dem Lobgesang zu Ehren der Heiligen Mutter Gottes heißt es: .Engel und Fürbitterin', und in dem Hymnus an den Heiligen Nikolaus, den Wundertäter: ,Engelgleicher', und so weiter. Uberall beginnt es mit dem Engel. Gewiß, man muß sich nach den anderen Kirchengesängen richten, ohne das geht es nicht, aber die Hauptsache ist ja nicht die Beschreibung des Lebens, nicht die Übereinstimmung mit dem übrigen, sondern die Schönheit und der Wohlklang. Alles muß harmonisch, kurz und doch ausführlich sein. In jeder Zeile muß Weichheit und Zartheit sein, und es darf kein einziges grobes, hartes oder unpassendes Wort darin stehen. Man muß so schreiben, daß der Betende' sich von Herzen freut Und weint und daß Angst und Zittern über seinen Verstand kommt. In einem Hymnus an die Mutter Gottes heißt es: .Freue dich, du Menschengedanken unzugängliche Höhe, freue dich, du Engelsaugen unsichtbare Tiefe.' Und an einer anderen Stelle: ,Freue dich, du goldfruchttragender Baum, von dem sich die Gläubigen nähren, freue dich, du schattenbelaubter Baum, der da viele schützt!'“
Jeronim bedeckte das Gesicht mit den Händen, “*als sei er vor iend ^twjis eiseh^ken od^er verlegen, uncksehüt^ telte den Kx>pW^\ ^&iV <
„Goldfruchttragender Baum . . . schattenbelaubter Baum...“ murmelte er. „Solche Worte hat er gefunden! Ja, Gott hatte ihm diese Fähigkeit gegeben! Um der Kürze willen müssen viele Worte und Gedanken zu einem einzigen Wort zusammengeballt werden, und wie fließend und treffend Nikolaj das alles ausdrücken konnte! .Lichtschenkende Leuchte' hat er in einem Lobgesang zu Ehren Jesu geschrieben. Lichtschenkend! So ein Wort kommt weder in Gesprächen noch in Büchern vor, er hat es sich ausgedacht, in seinem Verstand gefunden! Außer der fließenden Sprache und Beredsamkeit, Herr, muß jede Zeile auf alle mögliche Art verziert werden, Blumen müssen darin vorkorr'r~n, Blitz und Wind und Sonne und alle Gegenstände der sieht-