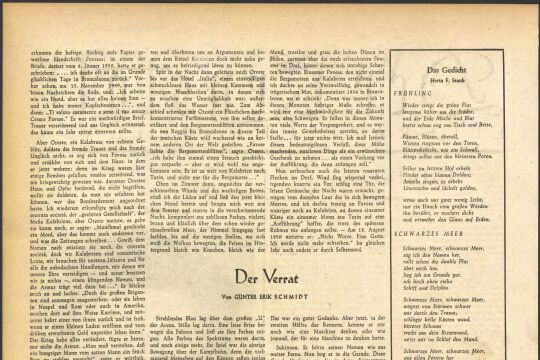RIO DE JANEIRO. Scheinbar selbstzufrieden wie ein finanzkräftiger Börsenmakler — bei nur 32 Cruzeiros in der Tasche — und mit dem müden Lächeln eines Siegers, den die eingegangenen Risiken zum Erfolg geführt haben, passierte ich die Hafenzollkontrolle. Stand ich doch am Ende einer mehrmonatigen Autostoppfahrt, die mir die Schönheiten der Neuen Welt gezeigt, aber auch die mannigfachen Arten des Gruseins beigebracht hatte. Vorbei an lärmenden Gepäckträgern, die Wie ein Heuschreckenschwarm auf die mit Koffern, Hutschachteln, Vogelkäfigen und Blumen bestückten Reiselustigen einherfielen, vorbei an Männern und Frauen, denen der bevorstehende Abschied Tränen- der Rührung auf die Wangen zeichnete, bahnte ich mir einen Weg zur „YA-PEYU“, meinem Schiff, das, von Buenos Aires kommend, in einigen Stunden nach Hamburg auslaufen sollte. Ungestüm hastete ich die Gangway hoch und wurde an Bord sogleich mit einem Steward konfrontiert, der mich dienstbeflissen nach dem Gepäck fragte und sich gleichzeitig nach meinen — nicht vorhandenen — Koffern bückte. Blindem Ehrgeiz immer schon abhold, zeigte ich mit einer lässigen Bewegung auf meinen zum Sturmgepäck avancierten Rucksade, der allerdings nur Verständnislosigkeit hervorrief. Kurioserweise erfolgte nun ein temperamentvoll geführter Diskurs über meine Koffer, die ich nie besaß, die ich aber vielleicht da und dort vergessen haben könnte. Man wollte einfach nicht wahrhaben, daß Südamerika auch ohne großes „Tamtam“ zu bereisen sei und sich auch einem besseren „Hans im Glück“ zeigte.
NACH DIESEM INTERMEZZO betrat ich also bei gleichgebliebener Gepäckstückanizähl — nämlich einem — Kabine 31, mein Zuhause für die kommenden 19 Tage. Es überraschte mich keineswegs, daß jeder meiner fünf Kabinemkameraden einer anderen Nationalität angehörte: Sie kamen aus Brasilien, Deutschland, Spanien, Schweden und Frankreich. Trotzdem herrschte in der Folge eine gute Kameradschaft, die auf einer Seereise einzige Basis eines gedeihlichen Zusammenlebens darstellt.
Mit knurrendem Magen, aber doch belustigt, beging ich einen gesellschaftlichen Fauxpas, der sich in der Folge zu einer amüsanten Groteske ausweitete: Als ich nämlich, nur mit Shorts angetan, im Speisesaal erschien, wurde ich dezent darauf verwiesen, daß dies einer Brüskierung der anderen Passagiere gleichkäme und ich wieder den Raum verlassen müsse. Solcherart mit der kuriosen Pedanterie südamerikanischer Bordetikette vertraut gemacht, schien es mir vorerst unmöglich, je wieder in das Reich der kulinarischen Genüsse •inaudringen, zumal meine einzigen salonfähigen „Beinkleider“ schon in Mexiko City ihren Dienst versagt hatten und ich sie Schuhputzern geschenkt hatte, die dann in mir einen berufsfördernden Gönner erblickten.
Nach Intervention des zuständigen Offiziers sollte mir in der Kabine — wie den I.-Klasse-Passagieren! — serviert werden. Daß aber gerade jener Steward dafür ausersehen war, der mir den Eintritt in den Speisesaal verwehrt hatte, rief bei mir höchste Schadenfreude hervor.
Die 70 Passagiere setzten sich aus drei Gruppen zusammen: Brasilianern, Spaniern und Deutschen. Unter letzteren befanden sich viele, die seinerzeit nach Brasilien auswanderten und sich in Blumenau, einer deutschen Siedlung südlich von Sao Paulo, niederließen. Die leidigen Verhältnisse im Land halten aber viele Neueinwanderer davon ab, ganz mit der Heimat *zu brechen, um die Möglichkeit einer Rückkehr aufrechtzuerhalten. Die Meinungen divergieren, ob es gemütlicher, besser' und unterhaltsamer ist, mit einem kleinen Schiff zu reisen oder einem großen, beispielsweise der „Rotterdam“ (mit der ich ebenfalls schon gefahren bin), den Vorzug zu geben. Voraussetzung ist natürlich, daß die finanzielle Situation dabei eine untergeordnete Rolle spielt. Sind es auf der „Rotterdam“ 17 Gesellschaftsräume, Cafes, Bars und Salons, die die Passagiere zu steifer Unterhaltung animieren, so müssen sich die „YAPEYU“-Reisenden mit einem Salon begnügen, in dem allerdings die Geselligkeit mehr die persönliche Stimmung zum Ausdruck bringen läßt und einen intimeren und wärmeren Kontakt mit sich bringt. Es ist ja klar, daß unter 1000 Passagieren nicht jener Gleichklang herrschen kann, wie ich ihn nun — auf dem 10.000-Tonnen-Schiff — erlebte.
WENN WIR REISENDE, SINNIEREND und den südamerikanischen Eindrücken nachhängend, im Deckstuhl der kontinuierlichen Lethargie verfielen, waren wir für jede äußerlich bedingte Unterbrechung dankbar. So auch für den öfteren Besuch des Kapitäns — in Schlafrock und Pantoffeln —, der sich recht eingehend nach unserem Wohlergehen erkundigte. Steht dies schon in krassem Widerspruch beispielsweise zur deutschen Borddienstvorschrift, so frappiert geradezu die Besuchszeit des ..Pantoffelhelden“: der frühe Nachmittag.
' Am fünften Tag der Seereise, dem Vorabend der Äquatortaufe, fand eine Schönheitskonikurrenz statt. Vorzeitig schon wurde dies bekanntgegeben, und die Spanier, verstärkt durch Portugiesen und Brasilianer, bildeten so eine Phalanx, die siegessicher die künftige „Miß YAPEYU“ in ihren Reihen wähnte. Wir Deutschsprechende starrten mit Neugierde und Verständnislosigkeit auf werbende Plakate, die in portugiesischer Sprache allen Passagieren eingehend suggerieren wollten,daß Morella Roncayolo, wohnend auf Kabine 94, die Schönste sei. Nicht etwa, daß wir frühzeitig die Flinte ins Korn warfen — es gab auch noch andere „Grazien“ —, sie war uns vielmehr gänzlich unbekannt! Urwüchsige Einwände — sie stammten von einem Bayern —, daß sie vielleicht Kleidermangels wegen die Kabine hüte und uns nur deswegen bisher Schönes vorenthielt, brachten uns der Personifizierung keinen Schritt näher, so daß wir mit Entzücken und dem Kampfruf „Laßt die Katze aus dem Sack!“ der Konkurrenz entgegensahen. Das so mit Vorschußlorbeeren bedachte Mädchen rechtfertigte bei der Veranstaltung keineswegs unsere hochgespielte Neugierde, wenngleich es mit viel Charme und Koketterie das Herz der Jury — teils Offiziere, teils Passagiere — erobern konnte und somit den Sieg davontrug. Um jedoch die anderen Mitwirkenden keiner traurigen Stimmung auszuliefern, verlieh das Preisgericht noch andere Titel und sorgte somit für ungetrübte Heiterkeit und allgemeine Zufriedenheit.
Der sechste Tag stand schließlich im Zeichen der Äquatortaufe, deren Ritus gegenüber früheren Zeiten stark „entschärft“ wurde, da ja dem Reisenden des 20. Jahrhunderts das „Kielholen“ kaum noch zugemutet werden kann. Unter der äquatorialen Sonnenglut lagen wir um das Schwimmbassin und harrten mit Interesse der Zeremonie, die um 15 Uhr beginnen sollte. All jene, die das erstemal den Äquator überfuhren — auch ich —, wurden angewiesen, ihre Meldung beim zuständigen Steward abzugeben, um dann bei gegebenem Anlaß dem Meeresgott die nötige Reverenz zu erweisen. Ein böser Zwischenfall ließ mich aber „ungetauft“: Da ich den Beginn der Kinderbadezeit — 14 Uhr — noch nicht für gekommen glaubte, sprang ich, ohne auf die Uhr zu blicken — Kopf voraus, die Arme angelegt —, ins Bassin. Voll Schreck mußte ich feststellen, daß der Wasserspiegel sehr niedrig stand, somit die Badezeit der Erwachsenen überschritten war und ich die Kleinen — wie der Blitz aus heiterem Himmel — jäh beim Plantschen störte. Ich prallte mit der Schädeldecke auf und glaubte im nächsten Moment, ersticken zu müssen, da die Wirbelsäule bei der Vehemenz des Aufpralls wuchtig nach hinten federte. Auch der Schultergürtel war enormem Drude — wenn auch nur für Bruchteile einer Sekunde — ausgesetzt, so daß ich glaubte, die Körpergröße längst vergangener Kinderjahre wiedererlangt zu haben. Glücklicherweise hatte man meinen Unfall bemerkt: Freunde hoben mich wieder an die Sonne und verständigten den Arzt. Es mag der Akzentuierung südamerikanischer Mentalität unterliegen, daß sich dieser zu einer Aussage hinreißen ließ, die auf mich äußerst befremdend wirkte: Er arbeite erst wieder um 17.30 Uhr!
RESIGNIERT UND VERÄRGERT war ich nun zum Zuschauen verurteilt und beobachtete aus dem Verborgenen die „Show“. vLärmend bewegten sich die mit einem Tau an-einandergebundenen Täuflinge über das Deck zum Schwimmbassin, während die Spitze des Zuges, Neptun — ein verkleideter Matrose — und die drei Schönsten der „YAPEYU“, durch ihren aufreizenden Ernst dem Geschehen die nötige Würde verleihen wollte. Zu Füßen des Mädchenterzetts, das die Meerjungfrauen verkörpern sollte, lauschten die „Delinquenten“ Neptuns Befehlen, schienen über deren Exzentrik aber sehr wenig begeistert und ergaben sich zuerst zaudernd, dann jedoch phlegmatisch ihrem Schicksal. Das Umkreisen der Meerjungfrauen auf allen vieren war aber nur ein spektakuläres Vongeplänkel. Ging es Neptun zuerst darum, seinen Meer-mädchen mit der Unterwürfigkeit der „Täuflinge“ zu schmeicheln, so war es in der Folge die Handlung der Kopfwäsche, die jene an den Beteiligten durchzuführen hatten. Eine Mixtur von Senf, Mayonnaise, Salat und Mehl ergoß sich als Waschmittel über die Köpfe der Unglücklichen, die dann noch, zum Gaudium aller Passagiere, für die Untersuchung der Schalenfestigkeit argentinischer Eier — die sich als äußerst minimal erwies — herhalten mußten. Dann packten kräftige Matrosenhände die solcherart gesalbten, ob ihrer zu-schandengerichteten Lockenpracht zappelnden und jammernden Äquatorneulinge und übergaben sie stimmgewaltig dem nassen Element: dem Schwimmbecken allerdings nur!
Die dann wieder eingetretene Ruhe schien auch vom Arzt Besitz ergriffen und ihn nachdenklich gestimmt zu haben. Denn er untersuchte mich — wenngleich es noch nicht 17.30 Uhr war — und verabreichte mir abschließend — „Aspirin“, wahrscheinlich der Nachfolger des einstigen nautischen Allheilmittels Whisky.
RIO DE JANEIRO. Scheinbar selbstzufrieden wie ein finanzkräftiger Börsenmakler — bei nur 32 Cruzeiros in der Tasche — und mit dem müden Lächeln eines Siegers, den die eingegangenen Risiken zum Erfolg geführt haben, passierte ich die Hafenzollkontrolle. Stand ich doch am Ende einer mehrmonatigen Autostoppfahrt, die mir die Schönheiten der Neuen Welt gezeigt, aber auch die mannigfachen Arten des Gruseins beigebracht hatte. Vorbei an lärmenden Gepäckträgern, die Wie ein Heuschreckenschwarm auf die mit Koffern, Hutschachteln, Vogelkäfigen und Blumen bestückten Reiselustigen einherfielen, vorbei an Männern und Frauen, denen der bevorstehende Abschied Tränen- der Rührung auf die Wangen zeichnete, bahnte ich mir einen Weg zur „YA-PEYU“, meinem Schiff, das, von Buenos Aires kommend, in einigen Stunden nach Hamburg auslaufen sollte. Ungestüm hastete ich die Gangway hoch und wurde an Bord sogleich mit einem Steward konfrontiert, der mich dienstbeflissen nach dem Gepäck fragte und sich gleichzeitig nach meinen — nicht vorhandenen — Koffern bückte. Blindem Ehrgeiz immer schon abhold, zeigte ich mit einer lässigen Bewegung auf meinen zum Sturmgepäck avancierten Rucksade, der allerdings nur Verständnislosigkeit hervorrief. Kurioserweise erfolgte nun ein temperamentvoll geführter Diskurs über meine Koffer, die ich nie besaß, die ich aber vielleicht da und dort vergessen haben könnte. Man wollte einfach nicht wahrhaben, daß Südamerika auch ohne großes „Tamtam“ zu bereisen sei und sich auch einem besseren „Hans im Glück“ zeigte.
NACH DIESEM INTERMEZZO betrat ich also bei gleichgebliebener Gepäckstückanizähl — nämlich einem — Kabine 31, mein Zuhause für die kommenden 19 Tage. Es überraschte mich keineswegs, daß jeder meiner fünf Kabinemkameraden einer anderen Nationalität angehörte: Sie kamen aus Brasilien, Deutschland, Spanien, Schweden und Frankreich. Trotzdem herrschte in der Folge eine gute Kameradschaft, die auf einer Seereise einzige Basis eines gedeihlichen Zusammenlebens darstellt.
Mit knurrendem Magen, aber doch belustigt, beging ich einen gesellschaftlichen Fauxpas, der sich in der Folge zu einer amüsanten Groteske ausweitete: Als ich nämlich, nur mit Shorts angetan, im Speisesaal erschien, wurde ich dezent darauf verwiesen, daß dies einer Brüskierung der anderen Passagiere gleichkäme und ich wieder den Raum verlassen müsse. Solcherart mit der kuriosen Pedanterie südamerikanischer Bordetikette vertraut gemacht, schien es mir vorerst unmöglich, je wieder in das Reich der kulinarischen Genüsse •inaudringen, zumal meine einzigen salonfähigen „Beinkleider“ schon in Mexiko City ihren Dienst versagt hatten und ich sie Schuhputzern geschenkt hatte, die dann in mir einen berufsfördernden Gönner erblickten.
Nach Intervention des zuständigen Offiziers sollte mir in der Kabine — wie den I.-Klasse-Passagieren! — serviert werden. Daß aber gerade jener Steward dafür ausersehen war, der mir den Eintritt in den Speisesaal verwehrt hatte, rief bei mir höchste Schadenfreude hervor.
Die 70 Passagiere setzten sich aus drei Gruppen zusammen: Brasilianern, Spaniern und Deutschen. Unter letzteren befanden sich viele, die seinerzeit nach Brasilien auswanderten und sich in Blumenau, einer deutschen Siedlung südlich von Sao Paulo, niederließen. Die leidigen Verhältnisse im Land halten aber viele Neueinwanderer davon ab, ganz mit der Heimat *zu brechen, um die Möglichkeit einer Rückkehr aufrechtzuerhalten. Die Meinungen divergieren, ob es gemütlicher, besser' und unterhaltsamer ist, mit einem kleinen Schiff zu reisen oder einem großen, beispielsweise der „Rotterdam“ (mit der ich ebenfalls schon gefahren bin), den Vorzug zu geben. Voraussetzung ist natürlich, daß die finanzielle Situation dabei eine untergeordnete Rolle spielt. Sind es auf der „Rotterdam“ 17 Gesellschaftsräume, Cafes, Bars und Salons, die die Passagiere zu steifer Unterhaltung animieren, so müssen sich die „YAPEYU“-Reisenden mit einem Salon begnügen, in dem allerdings die Geselligkeit mehr die persönliche Stimmung zum Ausdruck bringen läßt und einen intimeren und wärmeren Kontakt mit sich bringt. Es ist ja klar, daß unter 1000 Passagieren nicht jener Gleichklang herrschen kann, wie ich ihn nun — auf dem 10.000-Tonnen-Schiff — erlebte.
WENN WIR REISENDE, SINNIEREND und den südamerikanischen Eindrücken nachhängend, im Deckstuhl der kontinuierlichen Lethargie verfielen, waren wir für jede äußerlich bedingte Unterbrechung dankbar. So auch für den öfteren Besuch des Kapitäns — in Schlafrock und Pantoffeln —, der sich recht eingehend nach unserem Wohlergehen erkundigte. Steht dies schon in krassem Widerspruch beispielsweise zur deutschen Borddienstvorschrift, so frappiert geradezu die Besuchszeit des ..Pantoffelhelden“: der frühe Nachmittag.
' Am fünften Tag der Seereise, dem Vorabend der Äquatortaufe, fand eine Schönheitskonikurrenz statt. Vorzeitig schon wurde dies bekanntgegeben, und die Spanier, verstärkt durch Portugiesen und Brasilianer, bildeten so eine Phalanx, die siegessicher die künftige „Miß YAPEYU“ in ihren Reihen wähnte. Wir Deutschsprechende starrten mit Neugierde und Verständnislosigkeit auf werbende Plakate, die in portugiesischer Sprache allen Passagieren eingehend suggerieren wollten,daß Morella Roncayolo, wohnend auf Kabine 94, die Schönste sei. Nicht etwa, daß wir frühzeitig die Flinte ins Korn warfen — es gab auch noch andere „Grazien“ —, sie war uns vielmehr gänzlich unbekannt! Urwüchsige Einwände — sie stammten von einem Bayern —, daß sie vielleicht Kleidermangels wegen die Kabine hüte und uns nur deswegen bisher Schönes vorenthielt, brachten uns der Personifizierung keinen Schritt näher, so daß wir mit Entzücken und dem Kampfruf „Laßt die Katze aus dem Sack!“ der Konkurrenz entgegensahen. Das so mit Vorschußlorbeeren bedachte Mädchen rechtfertigte bei der Veranstaltung keineswegs unsere hochgespielte Neugierde, wenngleich es mit viel Charme und Koketterie das Herz der Jury — teils Offiziere, teils Passagiere — erobern konnte und somit den Sieg davontrug. Um jedoch die anderen Mitwirkenden keiner traurigen Stimmung auszuliefern, verlieh das Preisgericht noch andere Titel und sorgte somit für ungetrübte Heiterkeit und allgemeine Zufriedenheit.
Der sechste Tag stand schließlich im Zeichen der Äquatortaufe, deren Ritus gegenüber früheren Zeiten stark „entschärft“ wurde, da ja dem Reisenden des 20. Jahrhunderts das „Kielholen“ kaum noch zugemutet werden kann. Unter der äquatorialen Sonnenglut lagen wir um das Schwimmbassin und harrten mit Interesse der Zeremonie, die um 15 Uhr beginnen sollte. All jene, die das erstemal den Äquator überfuhren — auch ich —, wurden angewiesen, ihre Meldung beim zuständigen Steward abzugeben, um dann bei gegebenem Anlaß dem Meeresgott die nötige Reverenz zu erweisen. Ein böser Zwischenfall ließ mich aber „ungetauft“: Da ich den Beginn der Kinderbadezeit — 14 Uhr — noch nicht für gekommen glaubte, sprang ich, ohne auf die Uhr zu blicken — Kopf voraus, die Arme angelegt —, ins Bassin. Voll Schreck mußte ich feststellen, daß der Wasserspiegel sehr niedrig stand, somit die Badezeit der Erwachsenen überschritten war und ich die Kleinen — wie der Blitz aus heiterem Himmel — jäh beim Plantschen störte. Ich prallte mit der Schädeldecke auf und glaubte im nächsten Moment, ersticken zu müssen, da die Wirbelsäule bei der Vehemenz des Aufpralls wuchtig nach hinten federte. Auch der Schultergürtel war enormem Drude — wenn auch nur für Bruchteile einer Sekunde — ausgesetzt, so daß ich glaubte, die Körpergröße längst vergangener Kinderjahre wiedererlangt zu haben. Glücklicherweise hatte man meinen Unfall bemerkt: Freunde hoben mich wieder an die Sonne und verständigten den Arzt. Es mag der Akzentuierung südamerikanischer Mentalität unterliegen, daß sich dieser zu einer Aussage hinreißen ließ, die auf mich äußerst befremdend wirkte: Er arbeite erst wieder um 17.30 Uhr!
RESIGNIERT UND VERÄRGERT war ich nun zum Zuschauen verurteilt und beobachtete aus dem Verborgenen die „Show“. vLärmend bewegten sich die mit einem Tau an-einandergebundenen Täuflinge über das Deck zum Schwimmbassin, während die Spitze des Zuges, Neptun — ein verkleideter Matrose — und die drei Schönsten der „YAPEYU“, durch ihren aufreizenden Ernst dem Geschehen die nötige Würde verleihen wollte. Zu Füßen des Mädchenterzetts, das die Meerjungfrauen verkörpern sollte, lauschten die „Delinquenten“ Neptuns Befehlen, schienen über deren Exzentrik aber sehr wenig begeistert und ergaben sich zuerst zaudernd, dann jedoch phlegmatisch ihrem Schicksal. Das Umkreisen der Meerjungfrauen auf allen vieren war aber nur ein spektakuläres Vongeplänkel. Ging es Neptun zuerst darum, seinen Meer-mädchen mit der Unterwürfigkeit der „Täuflinge“ zu schmeicheln, so war es in der Folge die Handlung der Kopfwäsche, die jene an den Beteiligten durchzuführen hatten. Eine Mixtur von Senf, Mayonnaise, Salat und Mehl ergoß sich als Waschmittel über die Köpfe der Unglücklichen, die dann noch, zum Gaudium aller Passagiere, für die Untersuchung der Schalenfestigkeit argentinischer Eier — die sich als äußerst minimal erwies — herhalten mußten. Dann packten kräftige Matrosenhände die solcherart gesalbten, ob ihrer zu-schandengerichteten Lockenpracht zappelnden und jammernden Äquatorneulinge und übergaben sie stimmgewaltig dem nassen Element: dem Schwimmbecken allerdings nur!
Die dann wieder eingetretene Ruhe schien auch vom Arzt Besitz ergriffen und ihn nachdenklich gestimmt zu haben. Denn er untersuchte mich — wenngleich es noch nicht 17.30 Uhr war — und verabreichte mir abschließend — „Aspirin“, wahrscheinlich der Nachfolger des einstigen nautischen Allheilmittels Whisky.