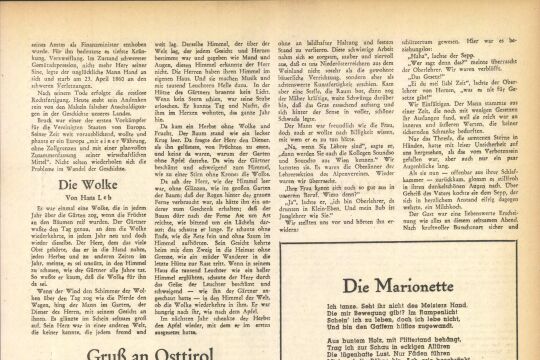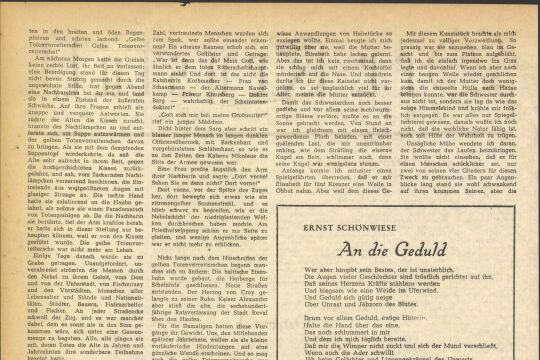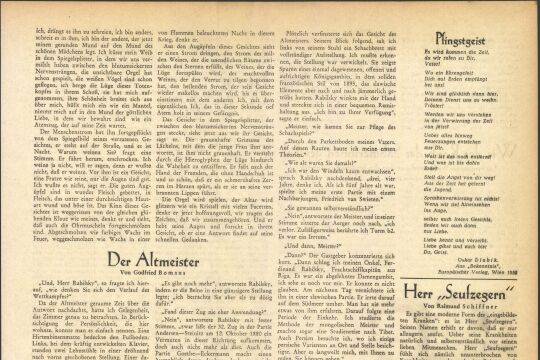Bei einem bedeutenden Mann ist vieles anders: Er speist, er weilt, er geruht, er 1st eine Persönlichkeit. Wenn es zunächst auch so aussah, als wäre er wie jedermann geboren worden, erfährt man eines Tages, daß er „das Licht der Welt erblickt“ hat, gleich nach dem Verlassen des Mutterleibes, noch an der Nabelschnur hängend, vor dem ersten Schrei. Anders als andere Menschen taucht er nicht erst allmählich aus Blindheit und schwarzen Nebeln, sondern erblickt sogleich das Licht jener Welt, die noch nicht ahnt, daß sie dazu bestimmt ist, ihm zu Füßen zu liegen.
Da jedoch die Fußlage zweifellos eine der unbequemsten Stellungen ist, tut die Welt alles, um zu verhindern, daß der bedeutende Mann zu dem wird, was er bereits ist. Man versucht, das Ereignis in die Nacht zu verlegen, in der das Licht der Welt durch ‘ künstliche Behelfe ersetzt wird, je künstlicher, desto besser. Seit die Kerze vom Glühfaden abgelöst ist, treten bedeutende Männer tatsächlich weniger häufig auf. Relativ weniger häufig wenigstens, gesehen im Verhältnis zum Wachstum der Weltbevölkerung.
Wirklich verhindern läßt es sich mit dem primitiven Beleuchtungstrick allein natürlich nicht. Vielleicht gelingt es, die Natur — aber wer weiß schon etwas über die Natur eines bedeutenden Mannes? — hin und wieder irrezuführen. Um die unerwünschte Vermehrung bedeutender Männer einzudämmen, mußte man sich mehr einfallen lassen. Ein schwieriges Problem stellen dabei die Eltern der allzu viel versprechenden Weiterblicker. Selbst bei völlig harmlosen Blindgeborenen gebärden sie sich, als nährten sie ein Weltwunder an ihrem Busen, obwohl das Risiko, daß es sich wahrhaftig um ein solches handelt, das bei derartigem Hätscheln zum Bewußtsein seines Wesens kommt, auch ihnen bewußt sein müßte.
Zum Glück erkannte man noch vor dem Überhandnehmen der bedeutenden Männer, wie wichtig es ist, die Kinder so früh als möglich der Unvernunft ihrer Eltern zu entziehen. Mit der Einführung der allgemeinen Schulpflicht nahm man zwar in Kauf, daß nun alle Kinder mit Kenntnissen ausgestattet wurden, die ehedem mit Recht als gefährlich galten, aber die Aufteilung auf so viele entmutigte gewiß manches Talent, ganz abgesehen davon, daß gewissenhafte Lehrer als treue Hirten ihre Schäflein vor Abwegen bewahren können. Das Verfahren war deshalb noch nicht ganz überzeugend, weil es einen ziemlich konstanten Prozentsatz an Wohlgearteten verdarb, die sich für bedeutend hielten, wenn sie mehr als das Abc und das Einmaleins beherrschten. Manche von ihnen, die erst von der Nachwelt entlarvt wurden, richteten unter den Zeitgenossen gräßlichen Schaden an und forderten überdies wirklich Bedeutende heraus, sich mit ihnen zu messen. Dennoch war die Einführung der allgemeinen Schulpflicht ein beachtlicher Fortschritt, und heute, im Besitz einer ausreichenden Anzahl von Kindergärten, dürfen wir hoffen, daß noch in diesem Jahrhundert die Erziehung zur Unbedeutung bis in die ersten Lebenstage vorverlegt wird.
Auch damit allerdings wird die Gefahr nicht endgültig gebannt sein. Wir wissen beispielsweise noch zu wenig über den Einfluß, den unbedachte Wünsche auf einen Neugebo renen haben können, der die Welt vielleicht nicht in vollem Licht erblickt, aber doch geblinzelt hat. Ein Kind in diesem zartesten Alter, das nicht einmal den Ansatz eines Schicksals in sich trägt, ist ja nicht nur den üblichen Umweltreizen wehrlos ausgesetzt. Und was soll man von einem Onkel halten, der einem unschuldigen Kind, in unserem Fall dem kleinen Franz („Bubi“) B., wünscht, es möge dereinst ein Generaldirektor werden?
Der Vater, Ministerialrat Anton B., erschrak. Er versuchte, das Unheil abzuwenden. „Aber geh’, Poldi“, sagte er. „Mir genügt es, wenn er ein glücklicher, zufriedener Mensch wird.“
„Und gesund", seufzte die Mutter, Frau Alice B., die daneben im Wochenbett lag.
„Ja, die Gesundheit“, gab Onkel Poldi zu, „die ist das Wichtigste.“
Liebvoll besorgt betrachteten sie das braunrote, verkniffene Frätzchen, das häßliche Fremdkörperchen in der blütenweißen Spitzenpracht des Steckkissens.
„Mir scheint, er blinzelt“, sagte der Vater.
„Das schaut nur so aus“, belehrte ihn die Mutter. „In dem Alter sind sie blind wie kleine Katzerln.“
Und wirklich war es, als presse der Bubi die Augen nur noch fester zu. Dann hob er ein lautes, weit ausholendes Quäken an, und die Mutter wies mit schämigem Lächeln die Herren aus dem Zimmer, um ihrem Kind die Brust zu reichen.
„Wie wird er denn heißen?“ fragte draußen Onkel Poldi.
„Franz Karl Johann“, sagte der Vater.
„Der Täufer?“ fragte der neugierige Onkel weiter.
„Nein, von Nepomuk.“
„Nicht sehr originell“, fand Onkel Poldi.
„Eben darum“, bestätigte der Vater.
Wunschgemäß entwickelte sich Bubi zu einem gesunden Buben und war im übrigen glücklich und zufrie den, beides allerdings in einem solchen Maß, daß es den Eltern einige Sorgen bereitete. Bubi ermangelte jeglichen Ehrgeizes. Anfangs legte man diesen Mangel als Bescheidenheit aus, aber als Bubi in die Schule kam, hätten es die Eltern doch vorgezogen, wenn er manchmal nicht ganz so glücklich und zufrieden gewesen wäre. Da er nicht über angeborene Geistesgaben verfügte — dazu war er viel zu gesund — und schon mit den geringsten Anregungen sein Auslangen fand, war er ein miserabler Schüler. Eine Fliege, die vor ihm über das Pult spazierte, stehenblieb und mit zierlich-energischen Bewegungen der vordersten Beinchen sich den Kopf putze, machte Bubi so glücklich und zufrieden, daß er den Lehrer völlig vergessen konnte.
Niemand brachte es fertig, ihm böse zu sein, wenn Bubi mit seinen gesunden Zähnen lächelte, aber ohne den Nachschub durch seinen Vater, der inzwischen zum Sektionschef aufgerückt war, hätte er kaum die Volksschule, geschweige denn das Gymnasium hinter sich gebracht. Erst an der Universität versagten sein Charme und die Beziehungen des Vaters.
Selbstverständlich trübte das in keiner Weise Bubis Glück und Zufriedenheit. Er hatte juristische Vorlesungen belegt, bis ihm nach fünfmaligem Mißerfolg bei der ersten Staatsprüfung kein Wiederholungstermin mehr eingeräumt wurde, und wechselte dann auf die philosophische Fakultät über, wo er angeblich Zoologie und Botanik studierte, in Wahrheit aber eine Zoologin oder
Botanikerin verehrte, die ihn auch später noch, als sie bereits mit einem Germanisten verheiratet war, glücklich und zufrieden machte. Er unternahm mit ihr gern kleine Exkursionen und trug die Botanisiertrommel. Während sie ihre Gräser rupfte und Käfer chloroformierte, saß er an einem Wiesenrain oder lag im Schatten eines Busches, schaute zu, wie die Sonne mit Wolken und Blättern spielte, und lauschte auf den Gesang der Vögel.
Als die Zoologin sich auf eine Abart von Wasserkäfem spezialisierte, die hin und wieder in Hochgebirgstümpeln, knapp über der Baumgrenze, anzutreffen ist, begleitete Bubi sie auch dorthin. Nur die sich mehrenden Schwangerschaften zwangen ihnen längere Pausen auf. Für Bubi waren sie nicht mehr als eine nette Unterbrechung eines netten Zustands. Er besuchte Freunde, bastelte ein wenig, schrieb ein paar Gedichte und war glücklich und zufrieden. Seine Eltern hatten sich im Lauf der Jahre daran gewöhnt, daß aus ihrem Sohn „nichts“ geworden war, ein gesunder, glücklicher, zufriedener Nichts. Der Sektionschef hatte beizeiten eine sehr hohe Lebensversicherung abgeschlossen und hoffte, daß das Geld im Notfall solange reichen würde, bis Bubi eine reiche Frau gefunden hätte, eine
Hoffnung, die bei einem so gesunden, glücklichen, zufriedenen Menschen, dem man all das auch noch ansah, sicher nicht unbegründet war.
Der Notfall trat ein, als* bei einer Dienstreise der Sektionschef und seine Gattin samt Chauffeur auf der Strecke blieben. „Der Arzt hat uns versichert, daß sie nichts gespürt haben“, sagte der Minister, als er Bubi am Grab sein Beileid ausdrückte. „Eigentlich ein schöner Tod.“ Der Pfarrer sagte, daß ihre Seelen aus dem von einem Tankwagen zerknüllten Mercedes in den Himmel aufgestiegen seien. Bubi glaubte beiden, dem Minister und dem Pfarrer, und schätzte sich unter reichlichen Tränen glücklich, daß er seine Eltern nicht auf schlimmere Weise verloren hatte. Nur die Versicherungsanstalt enttäuschte ihn, indem sie sich bankrott erklärte.
Bubi stand plötzlich ohne Mittel da. Trotzdem dachte er nicht einen Augenblick daran, sich etwa nach einer Arbeit umzusehen und damit Glück und Zufriedenheit in Frage zu stellen. Er schritt durch die schönen Räume der großen Wohnung, die er nun allein bewohnen sollte, und überlegte, in welcher Reihenfolge er Bilder, Teppiche und Möbel versilbern würde, als ihm bei einem Blick aus dem Fenster ein besserer Einfall kam.
Die Wohnung lag im obersten Stock eines noblen Lifthauses im Zentrum der Stadt. Aus dem Fenster sah man hinüber auf das Dach der „Mercuria“. Auch dort drüben waren Fenster, aber dahinter wohnte niemand. Es war ein ausgebauter Dachboden, auf dem, soviel man von herüben erkannte, allerhand Büroeinrichtung gelagert war, alte Schreibtische, Stühle, Garderobeständer, Kisten mit verjährten Akten und ähnlicher Kram. Bis auf den Staub, den man nur ahnte, ein recht gemütliches Stilleben. Warum, fragte sich der an Senn- und Alpenvereinshütten abgehärtete Bubi, sollte es nicht möglich sein, dort drüben eine Weile zu kampieren, während er die Wohnung in Untermiete gäbe? Wenn er dort drüben am Fenster stünde und herüberschaute, würde er sich fast zu Hause fühlen.
Bubi beschloß, sich sofort mit der „Mercuria" ins Benehmen zu setzen. Da er oft an trüben Tagen zum Zeitvertreib das Portal mit den drei gläsernen, marmorgefaßten Pendeltüren beobachtet hatte, wo es vom frühen Morgen bis in den späten Nachmittag wie am Flugloch eines Bienenhauses von seriösen, dunkelgekleideten Herren wimmelte, wählte er für den Besuch einen dunkelblauen Anzug mit feinem Nadelstreif. Den Versuch, seine gesunde, braune Gesichtsfarbe mit einer der nachgelassenen Lotionen seiner Mutter zu übertünchen, gab er auf, wusch das Zeug wieder herunter und vertraute statt dessen auf die angegrauten Schläfen.
Alles weitere wäre vermutlich anders gekommen, wenn nicht am selben Tag der alte Portier der „Mercuria“ zum letztenmal seinen Dienst in der kleinen Glasbox verrichtet hätte.
„Wie komme ich zu Ihrem Generaldirektor?“ erkundigte sich Bubi, der von Kompetenzen und Dienstwegen keine Ahnung hatte.
„Zweiter Stock links“, erwiderte der Portier in jener devoten Haltung, die ein Portier einnimmt, wenn der Name des Allmächtigen angerufen wird.
Bubi bestieg den Aufzug und drückte den Knopf, landete aber nicht auf dem schwellenden Spannteppich der Direktionsetage, sondern wurde in den sechsten Stock hochgeschossen, wo einer vor ihm gedrückt hatte.
Bei altmodischen Aufzügen in Häusern vom Rang der „Mercuria" sind solche Umwege üblich. Bubi hätte nun noch einmal den Zweierknopf drücken und mit dem Herrn, der oben gewartet hatte, abwärts fahren können, da er aber schon so weit war, überlegte er es sich anders. Was lag näher (eine Treppe höher), als einen Blick in den Abstellraum zu werfen, bevor er dem Generaldirektor seine Bitte vortrüge?
Die Tür stand offen, zwei blaugeschürzte Hausarbeiter hatten einen Schreibtisch abgestellt.
„Lassen Sie bitte den Schlüssel stecken“, sagte Bubi zu ihnen. „Ich werde dann absperren."
Als die Burschen gegangen waren, öffnete Bubi vor allem anderen ein Fenster, denn die Luft hier war stickig und schal wie in jedem unge- , lüfteten Abstellraum. Nicht ohne Rührung schaute er hinüber auf die , Front seiner Wohnung: Hübsch, sehr hübsch. Die Balkontür zum Eck- i salon war zurückgeschoben, man sah die Stehlampe, den Philodendron und den Fauteuil, in dem der Sektionschef seine Zeitung zu lesen gepflegt hatte. So gemütlich war es herüben doch nicht. Immerhin gab es neben dem Anschluß für den Feuerwehrschlauch sogar einen kleinen Wandbrunnen — an das Wasser hatte er gar nicht gedacht. Und in einer Ecke gab es eine von diesen praktischen Sitzbänken, die sich mit einigen kinderleichten Handgriffen in ein Bett verwandeln lassen. Der Bezug war zwar zerrissen: Immerhin. Und Schränke, Schreibtische und — ja, wie heißen die niederen Dinger? Kommoden? Bürokommoden? —: Also auch die niederen Dinger waren in solcher Fülle vorhanden, daß sie sich geradezu als Bauelemente anboten. Nicht einmal Putzfetzen und Kübel fehlten. Bubi zog den Rock aus, krempelte die Ärmel hoch und machte sich an die Arbeit.
Als er fertig war, das Nest zurechtgerückt und gesäubert hatte, vergoldete die späte Nachmittagssonne sein Werk. Er verschob den Generaldirektor auf morgen und kam eben noch vor Redaktionsschluß in die Anzeigenabteilung des „Neuen Kurier“.
Am folgenden Tag konnte er nicht aus dem Haus gehen, weil sich die Interessenten für die „Sonnige I-a- möblierte 5-Zimmer-Wg., Zentrallage“ die Klinke in die Hand gaben. Ein älterer Fabrikant vom Lande fand besonderen Gefallen an den breiten Ehebetten im Elternschlafzimmer und machte mit seiner appetitlichen Freundin das Rennen. Ein gutes Geschäft, das noch bessere Aussichten eröffnen sollte. Bubi packte den Mietzins für drei Monate, Pyjama, Zahnbürste und Rasierapparat in das Aktenköfferchen seines Vaters und übersiedelte.
Der neue Portier der „Mercuria“, dem der nadelgestreifte Herr nicht weniger neu war als die vielen Einfarbigen, grüßte devot, als Bubi, der seinen Weg nun ja schon kannte, an ihm vorbeischritt. In der Aufzugkabine zögerte er einen Augenblick zu lange: Wieder fand er sich im sechsten Stock wieder. Was lag näher, als erst einmal das Gepäck oben abzulegen? Den Schlüssel zum Abstellraum hatte er noch in der Tasche. Warum aber sollte er sich und den unbekannten Generaldirektor überhaupt mit einer Bitte, die doch einigermaßen ungewöhnlich klingen würde, in Verlegenheit bringen? Von drüben winkte die Freundin herüber, und Bubi winkte zurück.
So nahm das Verhängnis seinen Lauf. Nicht nur für den Portier war der elegante, sportlich gebräunte Herr bald eine vertraute Figur, allmählich ergaben sich auch Kontakte mit anderen, gehobenen Dienstnehmern der „Mercuria“. Da niemand genau um die Funktion wußte, die Bubi in diesem großen Unternehmen erfüllte, begegnete man ihm zuerst mit höflicher Zurückhaltung. Ein findiger Kopf brachte heraus, daß es sich um den engsten Vertrauten des Generaldirektors handelte. Wer sonst hätte nach Belieben so kommen und gehen dürfen, ohne Rücksicht auf die Dienststunden
Es ergab sich von selbst, daß Bubi in vertrackten Fällen um Rat ange gangen wurde. Wenn das Netz der Intrigen auch noch so fein gesponnen war, wollte man doch erfahren, was höchsten Ortes über gewisse Angelegenheiten gedacht wurde. Bubi antwortete immer ausweichend, das gab zu denken. Ihm machte es Spaß. „Bitte, Herr B., auf ein Wort!" Das war regelmäßig der Auftakt für eine lange, intime Unterhaltung. Manchmal verschwand er für einige Wochen, tauchte dann wieder auf, noch sportlicher, noch gebräunter. Man ahnte Dienstreisen, Kongresse in fernen Ländern, Diäten.
Als der Generaldirektor eines heiteren Vormittags unversehens unter der Last seiner Verantwortung zusammenbrach — „Herzinfarkt. Das mußte ja so kommen!" — und als der Aufsichtsrat im schwarz ausgeschla genen Sitzungszimmer zusammentrat, um den Nachfolger zu bestellen, war die Wahl nicht schwer. Leichter als Bubi zu finden. Aber einer der Direktionsassistenten schaffte es. Nachdem er das ganze Haus durchstöbert hatte, gelangte er bis an den Abstellraum, ein wenig atemlos von den sieben Stockwerken, die er ohne Lift bewältigt hatte. Nur weil er allein war, fürchtete er nicht, sich lächerlich zu machen. Die Tür wich vor der zum Klopfen erhobenen — ein Direktionsassistent klopft immer und überall, selbst vor dem Betreten der Toilette — die Tür wich vor der zum Klopfen erhobenen Hand zurück.
„Herr Generaldirektor“, keuchte der Direktionsassistent.
Bubi sperrte ab und steckte den Schlüssel in die Tasche. „Was haben Sie hier zu suchen?“ fragte er streng.
„Der Aufsichtsrat hat —“
Bubi nickte. Sein braungebranntes Gesicht strahlte vor Glück und Zufriedenheit, als er gemessenen Schrittes zu der Welt, die ihm zu Füßen lag, hinabstieg.
Zeichnungen: SUSANNE THALER