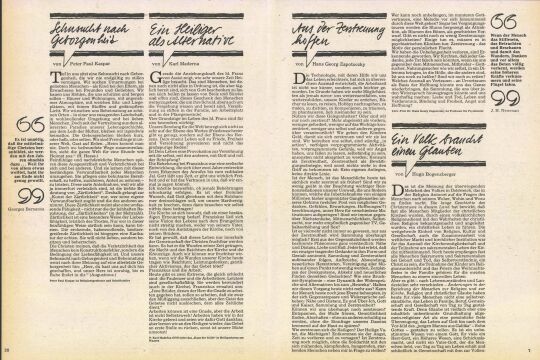Hilfe beim Sterben?
DISKURSAssistierter Suizid: Ein soziales Experiment
In der Dezember-Session des Verfassungsgerichtshofs stehen einmal mehr „Tötung auf Verlangen“ und „Mitwirkung am Suizid“ auf der Tagesordnung. Welche Folgen hätte eine Änderung des Status quo? Ein Gastkommentar.
In der Dezember-Session des Verfassungsgerichtshofs stehen einmal mehr „Tötung auf Verlangen“ und „Mitwirkung am Suizid“ auf der Tagesordnung. Welche Folgen hätte eine Änderung des Status quo? Ein Gastkommentar.
Noch immer warten wir mit Spannung auf das Urteil des Verfassungsgerichtshofs in der Frage des assistierten Suizids. Der Ausgang ist ungewiss, obwohl es nicht wahrscheinlich ist, dass alles beim Alten bleibt. (Mittlerweile ist das Urteil gefällt: Das Verbot von "Mitwirkung am Selbstmord" wird per 1.1. 2022 gekippt, Anm.) Das Folgende ist der Versuch einer Deutung in einer Situation, in der die Argumente von Befürwortern und Gegnern bekannt erscheinen.
Die aktuellen Entwicklungen um den assistierten Suizid und die aktive Euthanasie am Lebensende lassen sich als ein gesellschaftliches Experiment begreifen, von dem noch ungewiss ist, wie es ausgeht. Der Versuch, Suizid in bestimmten Situationen zu legalisieren, geschieht vor dem Hintergrund der bislang selbstverständlichen Überzeugung, dass „jeder Suizid“ eine „Tragödie ist“, wie in einer Publikation der WHO mit dem Titel „Suizidprävention. Eine globale Herausforderung“ aus dem Jahr 2014 zu lesen ist – eine Tragödie mit „Auswirkungen auf Familie, Freunde und Kommunen“, die „verheerend“ sind. Die Suizide, um die es hier geht, sind zahlenmäßig groß, in der Öffentlichkeit aber wenig präsent. Sie gelten, gerade auch als „Alterssuizide“, instinktiv und unwidersprochen als eine Katastrophe, als ein Versagen normaler psychischer Funktionen und als ein Versagen der Umwelt. Meist lassen sie traumatisierte Angehörige zurück.

Liebe Leserin, lieber Leser,
diesen Text stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung. Im FURCHE‐Navigator finden Sie tausende Artikel zu mehreren Jahrzehnten Zeitgeschichte. Neugierig? Am schnellsten kommen Sie hier zu Ihrem Abo – gratis oder gerne auch bezahlt.
Herzlichen Dank, Ihre Doris Helmberger‐Fleckl (Chefredakteurin)
diesen Text stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung. Im FURCHE‐Navigator finden Sie tausende Artikel zu mehreren Jahrzehnten Zeitgeschichte. Neugierig? Am schnellsten kommen Sie hier zu Ihrem Abo – gratis oder gerne auch bezahlt.
Herzlichen Dank, Ihre Doris Helmberger‐Fleckl (Chefredakteurin)
Im Zusammenhang mit dem Lebensende taucht nun der neue Typus eines „guten“ Suizids auf, der den Anspruch auf Rationalität, Nachvollziehbarkeit und gesellschaftlichen Respekt erhebt – und letztlich auch auf Hilfestellung. Damit werden nicht nur religiöse Normen und ein soziales „Tabu“ gebrochen. Es kommt notgedrungen auch zu Spannungen zum bisherigen Paradigma, das in Suiziden primär die Folge psychischer Krankheit und sozialer Belastungen sieht und von daher den Appell, solchen Menschen zu Hilfe zu kommen und gegenzusteuern, in den Mittelpunkt stellt.
Schwierige Abgrenzungen
Dieser Konflikt wäre so lange nicht bedrohlich, als der neue Typus klar abgrenzbar und eindeutig bestimmbar ist. Darin liegt der Sinn der gesetzlichen Regelungen, die versuchen, eine klare Abgrenzung zu schaffen, z. B. indem sie das Vorliegen einer unheilbaren Krankheit und Hinweise auf einen ernsthaften, beständigen Wunsch fordern. Ungewiss ist allerdings, wie weit sich solche Grenzziehungen halten lassen.
Die Irritation des deutschen Bundesverfassungsgerichts-Urteils vom Februar dieses Jahres liegt u. a. darin, dass solche Grenzziehungen unterblieben sind, weil es ohne Unterschied für ein Recht auf Suizid in allen Situationen plädiert. Wo wir bisher die Pflicht zum Widerstand hatten, könnten wir nun eine Beistandspflicht haben. Das ist das Dilemma vieler, die in der ärztlichen Akutversorgung und in der längerfristigen Betreuung von Menschen tätig sind. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass es zu einer Drift in die vielen anderen schwierigen und ausweglosen Situationen des Lebens kommt, in denen wir gemeinhin der Meinung sind, wir sollten sie produktiv bewältigen.
Nun ist Suizid tatsächlich ein äußerst schwieriges und komplexes Phänomen, was die Motive und die Bedingungen für sein Zustandekommen, aber auch seine ethische Bewertung betrifft. Er ändert sein Gesicht, je nachdem, ob man ihn psychotherapeutisch, sozialökonomisch, philosophisch oder religiös betrachtet. Philosophen verteidigen oft die Freiheit, Psychologen und Mediziner zweifeln daran, Religionen sehen darin eine Auflehnung gegen Gott. All das könnte bedeuten, dass wir diesem Phänomen in seiner Komplexität tatsächlich noch nicht gerecht geworden sind und für differenziertere Zugänge offen sein sollten.
Die aktuellen Entwicklungen fordern auch die katholische Kirche heraus, ihre bisherige Haltung zum Suizid neu zu durchdenken. So hat man in der Moraltheologie kaum die Frage zugelassen, welche Rolle die inneren Motive eines Menschen bei der Beurteilung spielen und ob es etwa einen Unterschied macht, ob Menschen in der Lebensmitte Suizid verüben oder am Ende eines verantwortungsvoll gelebten Lebens. Zusätzlich stellt sich die Frage, wie Suizide von Menschen zu sehen sind, die ihr Leben nicht als eine von Gott anvertraute Aufgabe erkennen können. Wogegen versündigen sie sich?
Dramatischer Anstieg? Randphänomen?
Zu einem Experiment gehört, dass der Ausgang ungewiss ist, dass man noch nicht alles weiß. Auch dies muss man sich für die aktuelle Situation eingestehen. Ungewiss ist, ob die Nachfrage nach einem assistiertem Suizid dramatisch steigen oder ob dies ein Randphänomen bleiben würde, ob es zu der erwähnten Drift in andere Lebenssituationen hineinkommen würde oder nicht, ob Gerichte zukünftig auch ein Recht auf aktive Tötung feststellen würden und schließlich, inwieweit es eine Resilienz gegenüber einem möglichen sozialen Druck gäbe.
In einer solchen Situation muss man offen für neue Einsichten sein, es muss aber auch verhindert werden, dass das Experiment eine unkontrollierbare Eigendynamik bekommt. Es braucht, sollte es zu einer Öffnung kommen, tatsächlich Wachsamkeit gegenüber den verschiedenen Formen eines möglichen Dammbruchs. Gleichzeitig ist das positive Engagement für eine Sterbekultur notwendig, die ohne Tötungshandlungen auskommt, denen immer etwas Gewalttätiges anhaftet. Schließlich sollte man sich den Respekt vor Menschen und ihrem Gewissen bewahren, die in bestimmten ausweglosen Situationen für sich keinen anderen Ausweg als einen assistierten Suizid sehen.
Die Kirche(n) sollten weniger zögerlich sein, ihre skeptische Haltung auch religiös zu begründen, nicht im Sinn von Verurteilungen, sondern indem erklärt wird, welche grundlegenden Einstellungen glaubende Menschen zum Leben, seinem Sinn und zum Umgang mit seinen Grenzen haben. Dass viele antworten werden, sie seien eben nicht religiös, bedeutet nicht, dass diese Fragen nicht alle beschäftigen, dass über solche Fragen keine Kommunikation möglich wäre.
Der Autor ist Mediziner und emeritierter Professor für Moraltheologie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Graz.

Hat Ihnen dieser Artikel gefallen?
Mit einem Digital-Abo sichern Sie sich den Zugriff auf über 40.000 Artikel aus 20 Jahren Zeitgeschichte – und unterstützen gleichzeitig die FURCHE. Vielen Dank!
Mit einem Digital-Abo sichern Sie sich den Zugriff auf über 40.000 Artikel aus 20 Jahren Zeitgeschichte – und unterstützen gleichzeitig die FURCHE. Vielen Dank!
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!