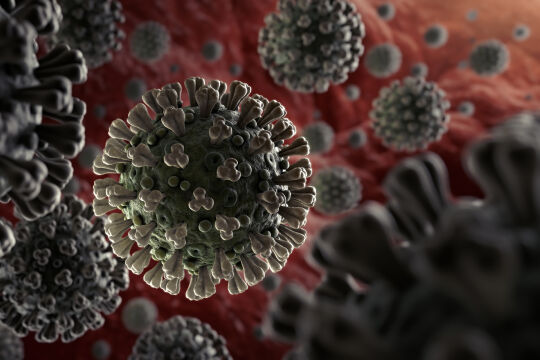Hilfe beim Sterben?
DISKURS"Sterbehilfe": Keiner ist eine Insel
Wie das Coronavirus lehrt, was der Schutz vulnerabler Personen bedeutet. Und warum Autonomie in der „Sterbehilfe“ nur die halbe Wahrheit ist. Ein Gastkommentar von Susanne Kummer.
Wie das Coronavirus lehrt, was der Schutz vulnerabler Personen bedeutet. Und warum Autonomie in der „Sterbehilfe“ nur die halbe Wahrheit ist. Ein Gastkommentar von Susanne Kummer.
Deutschland hat mit dem jüngsten Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 26. Februar 2020 das Tor für eine „geschäftsmäßige Beihilfe zum Suizid“ geöffnet (die FURCHE berichtete). Begründet wurde dies damit, dass es ein Grundrecht auf einen selbstgewählten Tod unter Mithilfe durch andere gebe. Die eigene Todesart zu wählen, sei ein „Akt autonomer Selbstbestimmung“ – im Prinzip für Gesunde genauso wie für Kranke, so die deutschen Richter. Die Folgen für Deutschland sind noch nicht absehbar. Der Schweizer Sterbehilfe-Verein „Dignitas“ kündigte jedenfalls bereits an, seine „Dienste“ für zahlende Mitglieder ab sofort auch in Deutschland anbieten zu wollen.
Befürworter der Beihilfe zur Selbsttötung und Tötung auf Verlangen argumentieren mit Autonomie und Selbstbestimmung, die beide zweifellos sehr hohe Güter darstellen. Keiner will sich von anderen vorschreiben lassen, wie er zu leben hat. Interessant ist allerdings auch, was wir gerade in der Corona-Krise erleben. Sie zeigt uns, worauf es im Ernstfall ankommt – und warum die Konzepte von menschlicher Autonomie und Selbstbestimmung in einen größeren Rahmen gestellt werden müssen: in jenen von Verletzlichkeit, Schutz und Solidarität, gerade dann, wenn es um Krankheit und Sterben geht. Denn Autonomie und Selbstbestimmung sind nur die halbe Wahrheit.
Die andere Hälfte ist weniger schön. Menschen, die sich mit Tötungsgedanken befassen, leben nicht auf einer seligen Insel der Autonomie. Im Gegenteil: Wer schwer krank, einsam oder gebrechlich ist, befindet sich in einer höchst verletzlichen Phase seines Lebens. Die Angst oder auch die Tatsache, anderen zur Last zu fallen, kann Betroffene in eine Sackgasse tiefer Isolation und Hoffnungslosigkeit treiben.
Einsparen durch „Euthanasie“
Kranke, schwache oder vulnerable Menschen fühlen sich in unserer dominierenden Leistungsgesellschaft ohnehin schon häufig als „Last“ für die anderen. Der Gedanke, dass sie das alles ihrer Umgebung jederzeit ersparen könnten, wird zur Option, die sie wählen können. In Kanada gibt es bereits Berechnungen, wieviel Geld man durch „Euthanasie“, wie sie dort unverblümt genannt wird, einsparen kann. Pflegebedürftige geraten damit unter einen Rechtfertigungsdruck – aber auch ein Gesundheitssystem, das sich Pflege und Hospiz noch leistet. Aus dem Recht auf den begleiteten Suizid wird so eine Pflicht zum sozialverträglichen Frühableben. Hier sind Machtstrukturen wirksam, die es klar zu benennen gilt.
Wer in so einem gesellschaftlichen Klima die Beihilfe zum Suizid als geglückten Fall von Autonomie hochstilisiert, übersieht die existentiell soziale Dimension des Menschen: seine fundamentale Angewiesenheit auf andere, sein Eingebunden-Sein in Gemeinschaft. Suizid ist keine Privatsache. Wir alle sind miteinander verbunden, keiner ist eine Insel für sich. Deshalb setzt sich im ethischen Diskurs übrigens das Konzept der „relationalen Autonomie“ immer mehr durch, wonach es keinen Widerspruch zwischen Autonomie und Abhängigkeit gibt. Frei nach Martin Buber: Das Ich gewinnt sich erst am Du.
Suizide sind nicht einfach wertneutral, jeder Suizid ist einer zu viel. Doch mit der Freigabe der Beihilfe zum Suizid wird eine gefährliche Entwicklung in Gang gesetzt, die die gesamte Suizidprävention unterhöhlt. Der Staat kann nicht zwischen „guten“ und „schlechten“ Suiziden unterscheiden, er muss dann alle respektieren. Dass Suizid ansteckend ist, zeigen Studien zum sogenannten „Werther-Effekt“. Im Jahr 2016 haben sich fünf Mal mehr Schweizer mittels Sterbehilfe-Organisationen das Leben genommen als noch 2003. Mit insgesamt 2000 Suiziden jährlich meldet die Schweiz keinen Rückgang, sondern eine Steigerung der Gesamtzahl der assistierten und „normalen“ Suizide.
Die Solidarität mit Menschen in Lebenskrisen verlangt es, dass unser Rechtssystem dem Willen Einzelner Grenzen setzt. Jeder kann Behandlungen ablehnen, auch wenn dies sein Sterben beschleunigt oder zu seinem Tod führt. Aber keiner darf jemand anderen dazu bestimmen, ihn durch Mitwirkung an seinem Suizid oder Durchführung einer Handlung zu töten. Aufgabe des Staates ist es nicht, Tötungswünsche zu regeln, sondern Leben zu schützen.
Beistand statt Hilfe zur Selbstauslöschung
Zurecht halten auch Ärzte und Pflegende die Kooperation bei Tötungswünschen mit ihrem beruflichen Ethos für unvereinbar. Wer in einer existentiellen Krisensituation wie Krankheit und Hochaltrigkeit einen Sterbewunsch äußert, braucht keine Hilfe zur Selbstauslöschung, sondern heilsame Begegnungen, Schmerzlinderung, Zuwendung und Beistand. Nur so kann jeder Mensch sich sicher sein, dass er in seiner Würde auch in verletzlichen Lebensphasen geachtet und geschützt wird.
Unsere Kultur lebt davon, dass wir auch an den Grenzen des Lebens zueinanderstehen. Seien wir präzise in unserem Sprachgebrauch: Es gibt ein Recht auf Leben. Es gibt ein Recht darauf, dass Sterben nicht unnötig verlängert, sondern zugelassen wird. Aber es gibt kein Recht auf Tötung. Aus dem Recht auf Selbstbestimmung kann daher weder ein Recht noch die Pflicht des Arztes oder anderer Personen zur Mithilfe oder die Tötung seiner Patienten auf Wunsch abgeleitet werden.
Mit der Coronavirus-Krise rückt ein zentraler Begriff der Medizin- und Pflegeethik ins Bewusstsein: die Vulnerabilität und Verletzlichkeit des Menschen als conditio humana. Wir alle nehmen in diesen Wochen dras-tische Einschränkungen im privaten und öffentlichen Leben in Kauf, um gefährdete Personengruppen wie Ältere oder Menschen mit Vorerkrankungen vor einer Ansteckung zu schützen. Der Staat hat das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen eingeschränkt zum Schutz der Schwächeren und Verwundbaren. Und das ist gut so. Im Kern muss dieser Gedanke der Solidarität jede Gesellschaft tragen, wenn es um den bestmöglichen Schutz vulnerabler Gruppen geht.
Die Autorin ist Ethikerin und Geschäftsführerin von IMABE – Institut für Medizinische Anthropologie und Bioethik in Wien.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!