Rossinis „Moïse et Pharaon“ bei den Salzburger Festspielen: Durch subtile Phrasierung hob Riccardo Muti die melancholische Note überzeugend hervor. Jürgen Flimm scheiterte an einer gemäßen szenischen Realisierung.
„Wer bürgt für unsere Hoffnung?“, fragen die älteren Hebräer. Gott selbst ist es schließlich, der ihnen durch Moïse den Weg durch das Rote Meer, damit die Flucht aus ägyptischer Unterdrückung weist. Beim Versuch nachzusetzen, werden die Ägypter von den Wellen erfasst. Zweimal hat Rossini dieses Sujet vertont: 1818 hatte „Mosè in Egitto“ in Neapel Premiere. Als Rossini 1824 zum Direktor des Théâtre Italien in Paris bestellt wurde, erinnerte er sich dieses Werks, arbeitete die dreiaktige italienische Oper grundlegend zu einer vieraktigen französischen Grand Opéra um, verwandelte, wie man anlässlich der Uraufführung von 1827 in Paris lesen konnte, „die ausgezeichnete Skizze eines jungen Künstlers in die vollendete Komposition eines reifen Genies“.
Ein ernster Rossini
2003 eröffnete Riccardo Muti mit dieser Opéra en quatre actes die neue Saison an der Scala. Jetzt brachte er sie zu den Festspielen nach Salzburg; entsprechend seiner Überzeugung, dass sich Rossini in seinen ernsten Opern weitaus stärker präsentiere als in seinen ungleich bekannteren komischen Opern. Deutlicher noch als seinerzeit in Mailand hob er an der Spitze der blendend vorbereiteten und mit eleganter Spielfreude ausgestatteten Wiener Philharmoniker und der ebenso präzise agierenden, wortdeutlichen Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor (Einstudierung: Thomas Lang) – Orchester und Chor stehen den Solisten gleichberechtigt gegenüber – durch überlegte Tempowahl und subtile Phrasierung überzeugend die melancholische Note dieses Musiktheaters hervor, das biblisches Geschehen mit einer Liebesgeschichte kombiniert.
Denn Themen dieses Rossini sind gleichermaßen die Auseinandersetzung zwischen den vom Isis-Kult beherrschten Ägyptern und den vom Monotheismus geprägten Juden wie das unglückliche Liebesverhältnis zwischen dem Pharaonensohn Aménophis und Anaï, der Nichte des Moses. Ihr ist am Ende die Zugehörigkeit zum eigenen Volk wichtiger als die Erfüllung ihrer subjektiven Leidenschaft.
Was hätte sich aus dieser Vorlage machen lassen! Wie Luca Ronconi in Mailand, der „Moïse“ zum statischen Oratorium stilisierte, scheitert auch Jürgen Flimm an einer gemäßen szenischen Realisierung. Wobei offen bleiben muss, wie sehr die Buhrufe nach der Premiere nicht auch der Art seines vorzeitigen Abgangs aus Salzburg galten.
„Du sollst nicht töten“
Flimm lässt die Handlung in einer in die Höhe verjüngten Art Klagemauer-Rund (Bühne: Ferdinand Wögerbauer), das im Finale den Weg zur Flucht freigibt, ablaufen. Zur Linken sind den vierstündigen Abend über drei Personen damit beschäftigt, die offensichtliche Quintessenz dieser Inszenierung an die Mauer zu malen: Du sollst nicht töten. Im Vordergrund die Choristen und Hauptdarsteller, begleitet von Koffern, Gesetzestafeln oder in gemütlichen Fauteuils sitzend. Eine detaillierte Charakterisierung der einzelnen Darsteller wird erst gar nicht angestrebt. Auch Birgit Hutters Kostümidee, die Hebräer als orthodoxe Juden, die Ägypter als Araber auftreten zu lassen und damit die unvermittelte Aktualität dieses Sujets ins Spiel zu bringen, greift die Regie nicht weiter auf. Stattdessen rückt ein schwarzer Vorhang in den Mittelpunkt: einerseits um die Bühne zu reduzieren und so gezielter den Fokus auf einzelne Personen zu richten, vor allem aber, um darauf unterschiedlich gut lesbare Ausschnitte aus dem Buch Exodus und Psalmentexte zu projizieren. Als ob noch so überlegt ausgesuchte Texte Personenführung und Sujetdeutung jemals ersetzen könnten. Da wundert es auch nicht, wenn das Ballett nur instrumental ausgeführt und ebenfalls zu einer Lesestunde umgedeutet wird.
Dafür stimmte es vokal, denn mit Ildar Abdrazakovs stimmgewaltigem, klar zeichnendem Moïse, Nicola Alaimos sonorem Pharaon, Eric Cutlers energiegeladenem Aménophis, Nino Surguladzes höhensicherer Pharaonenfrau Sinaïde, Juan Francisco Gatells formidablem Éliézer und Marina Rebekas emphatisch gestaltender, strahlend leuchtender Anaï war eine den hohen Ansprüchen von Rossinis vielschichtiger Partitur entsprechende, zudem homogene Sängerbesetzung aufgeboten.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!





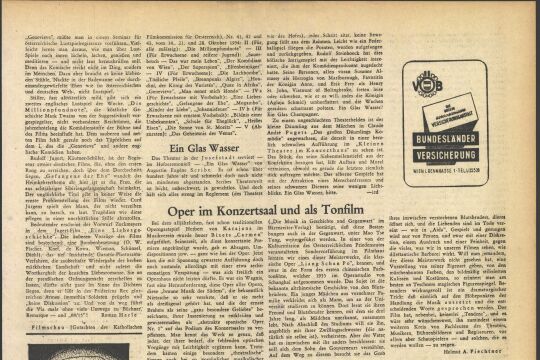



































































%20OFS_Monika%20Rittershaus%20(16).jpg)


















_edit.jpg)






