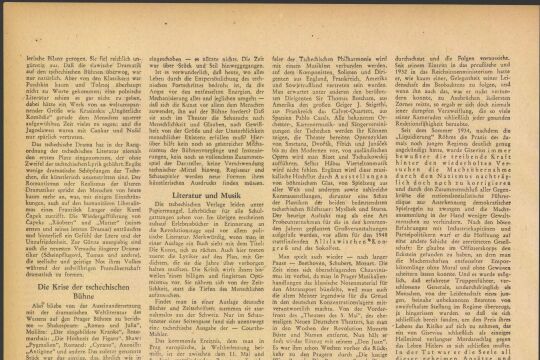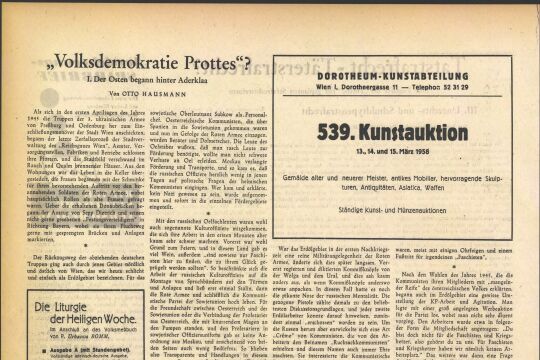Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Das Ende des Reiches
„Da las ich gestern die Notiz über ein österreichisches Kriegsgefangenenlager“ schrieb Franz Theodor Csokor am 26. Juli 1935 an seinen Freund Ferdinand Bruckner. Und diese Zeitungsnotiz — vielleicht eine „Ente“, vielleicht wahr in ihrer ganzen Unwahrscheinlichkeit — ließ ihn nicht mehr los: Offiziere an der russisch-chinesischen Grenze, die einer Armee ohne Reich angehörten, die einem Kaiser Treue geschworen hatten, der nicht mehr lebte, erfahren plötzlich, 1928, daß alles zu Ende ist. Die Reaktion: Selbstmorde, Streit, Verzweiflung, das alles arbeitete in ihm Monate hindurch. Und dann war das Stück fertig, im Juli 1936, entstanden unter dem Eindruck dieser kleinen Notiz, aber auch unter der Drohung von jenseits der Grenzen, deren Schatten sich immer schwerer auf Österreich legte.
Die Erinnerung an das, was am
3. November 1918 auseinandergebrochen war, nochmals wachzurufen, war damals auch in Österreich nicht mehr ganz einfach. Sätze wurden „vorsichtshalber“ gestrichen, die etwa den Vertragspartner des eben geschlossenen Juniabkommens hätten stören können. Dennoch: Das Stück, zu dem Csokor gemeinsam mit ödön von Horvath den Titel gefunden hat, wurde zu einem Erfolg — sehr zur Überraschung des damaligen Burgtheaterdirektors. Die Handlung kommt im Kern von jener Zeitungsnotiz: ein abgeschnittenes Offizierslazarett hoch in den Bergen, eine Handvoll Offiziere der verschiedenen Nationalitäten des alten Reiches, ein Regimentsarzt, eine Krankenschwester und zwei Soldaten. Alle tragen noch den kaiserlichen Rock von verschossenem Grau, die Kokarde an der Kappe, alle verbindet das Du der alten Armee. Da bringt ein Matrose die Nachricht vom Ende: Die kleine Gemeinschaft löst sich auf, zunächst in Sieger — wie die beiden Leutnants, die jetzt Tscheche und Italiener sind — und in Besiegte, dann in Feinde, die sich bald darauf in Kärnten mit der Waffe in der Hand gegenüberstehen. Nur einer hat kein Zuhause mehr: der aktive Artillerieoberst Radosin. Die Armee, für ihn seit der Kadettenschule Ersatz für alle familiäre Bindung, besteht nicht mehr. Eine Institution ist damit zusammengebrochen, die dem Offizier das Weiterleben unmöglich macht. Er wählt den Freitod. An seinem Grab sammeln sich noch einmal die Nationen, vertreten durch die Kameraden von gestern. Dann gehen sie auseinander, in die sich eben etablierenden Nationalstaaten, noch in der alten Uniform, doch ohne Kokarde.
Die alte Ordnung ist zerbrochen, das alte Reich besteht nicht mehr. Und die nun anbrechende neue Zeit
— ob sie eine große Zeit werden wird, das wissen die Heimkehrer von 1918 noch nicht — wird von Feuerstößen des „Schwarzlose“-Maschi- nengewehrs eingeleitet...
Diese Parabel vom Ende der Donaumonarchie soll künftig stets am 26. Oktober, am Nationalfeiertag, im Burgtheater aufgeführt wer den. Das neue Österreich könnte kein würdigeres Stück wählen, um die unlösbare Verbindung der Republik zur vielhundertjährigen österreichischen Geschichte zu dokumentieren. Und wenn über dem Grab des kaiserlichen Offiziers der rotweißrote Kommandowimpel der Kriegsmarine flattert, so ist dies viel mehr als billige Symbolik.
Fred Hennings, der in der Uraufführung den Oberleutnant Ludoltz gespielt hatte, spielt nun wiederum
— wie schon vor einigen Jahren — den Radosin: stiller, weniger Truppenoffizier als Militärhistoriker. Ein
Gelehrter im bunten Rock, wie sie in der alten Armee nicht selten waren. Wolf Albach-Retty, Erich Auer, Otto Kerry, Alexander Trojan und Ernst Anders sind die Offiziere: echt in der Charakterisierung der unsichtbaren Trennwand zwischen Aktiven und Reserveoffizieren. Josef Meinrad charakterisiert unauffällig, doch in jeder Geste scharf, den wie versehentlich in feldgrau gekleideten jüdischen Arzt. Michael Janisch — mit „Flinserl“ im Ohr — und Fritz Lehmann: ein Markthelfer mit
Sehnsucht nach den „entern Gründ“ und ein allzu zittriger Landstürmer. Fehlbesetzt Kurt Meisel als Maschinenmaat Kacziuk, weil eher aus Kiel oder Petersburg kommend als aus Pola. Sympathisch Sylvia Lukans Krankenschwester. Die Retuschen dim letzten Akt — der bisher stets ein wenig peinlich war — haben nicht geschadet.
Fritz Judtmanns Bühnenbild liefert den denkbar besten Rahmen, Eduard Volters’ Regie — ein Debut
— ist unaufdringlich: Jeder spielt sich selbst. Und das ist — bei genannter Besetzung — nicht das Schlechteste.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!