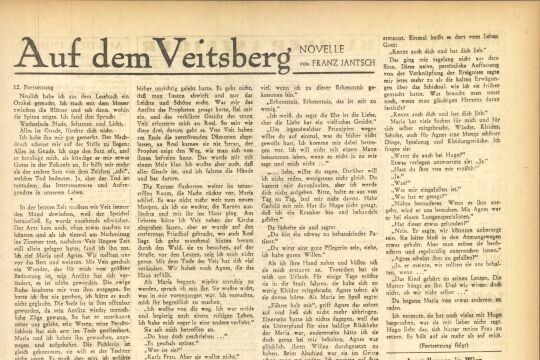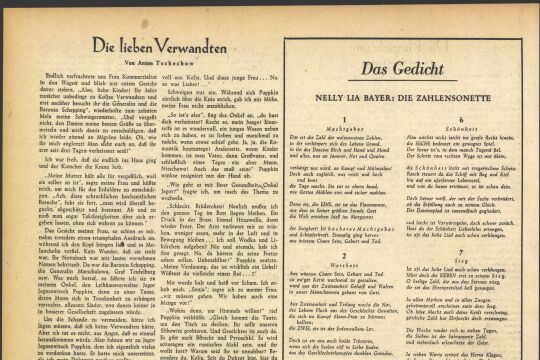Man schrieb Faschingsonntag 1855. Ein linder Frühlingswind strich durch die Straßen des kleinen Städtchens Motta, in der Nähe von Oderzo gelegen, wo Pave von Preradovic, die Gattin des kaiserlichen Majors Petar von Preradovic, mit ihren kleinen Kindern seit Monaten zu Besuch bei ihrer Schwester weilte, um ihre angegriffene Lunge auszuheilen.
Man saß gerade beim Mittagessen, die Kinder in Faschingskostümen, als Vizza, das Dienstmädchen, mit fliegenden Haaren hereingestürzt kam und rief, es sei Besuch da, ob der Herr Doktor nicht herauskommen wolle. Aber ehe Miho sich noch erheben konnte, stand ein zartgebauter, dunkelhaariger Offizier mit Hauptmannssternen am Kragen im Türrahmen, verbeugte sich vielmals und rief lachend: „Guten Appetit!“ Die ganze Tafelrunde bis auf die kleinen Töchter Paves, Miliza und Cotia, die verständnislos dreinstaunten, erhob sich mit freudigen Ausrufen, Miro stürzte mit dem Schrei: „Der Onkel Toni ist da!“ wie besessen auf den Ankömmling los, die Frauen breiteten lachend die Arme aus und riefen in glücklichem Tone: „Der Toni, der Toni!“ Miho, der Schwager Paves. streckte dem Gast beide Hände entgegen und holte einen Stuhl für ihn herbei, und während Pave und Bepi, ihre Schwester, ihn strahlend umarmten und küßten und Vizza Teller und Bestecke brachte, saßen Miliza und Cotia verschüchtert da und zupften die Mutter mit der Frage, wer denn das sei. „Ach, meine armen Mädchen, ihr kennt den Onkel Toni nicht!“ rief Pave lachend. „Das ist doch mein lieber Bruder!“ Sie lief nochmals zu dem Angekommenen und küßte ihn stürmisch auf beide Wangen. Er umarmte sie und streichelte ihr Gesicht und setzte sich endlich an der Seite seines Schwagers nieder, um nun ebenfalls Suppe zu löffeln. Dabei plauderte er fröhlich und unausgesetzt auf eine stille und freundliche Weise, er sah sich immer wieder im Kreise um und lachte jeden am Tisch glücklich an.
„Ah, meine Lieben, das ist mir also gelungen! Seht ihr, das freut mich so unbändig, daß ich nun hier bei euch sitzen kann. Ich hatte die ganze Fahrt lang geträumt und mir ausgemalt, daß ich am Faschingsonntag bei euch hereinspazieren würde, gerade wenn ihr anfangt, die Suppe zu essen. Wie groß deine Töchter geworden sind, Pave, die Kleine da lag in den Kissen, als ich euch vor zwei Jahren in Cremona besuchte. Und nun hast du ja einen Sohn bekommen! Und Miro, mein Freund, du bist nun wohl schon bald ein General, will mir scheinen.“
Pave wünschte zu wissen, ob ihr Bruder aus Mailand komme.
„Freilich, auf dem kürzesten Weg. Und ebenso direkt werde ich Dienstag früh zurückfahren, denn ich habe im ganzen knappe drei Tage Urlaub bekommen, nur gerade über das Faschingsende.“
Nun erhob sich allgemeines enttäuschtes Gejammer, die Schwestern und der Schwager bestürmten den Hauptmann, doch länger zu bleiben; Miro, der kleine Neffe Paves, sprang auf, packte den Onkel am Arm und schrie, er lasse ihn nicht fort. Die kleinen Mädchen sahen scheu lächelnd und mit aufgerissenen Augen in den Tumult.
„Da kann man nichts machen, meine Lieben! Laßt uns froh sein, daß mir diese Eskapade gelungen ist. Bis gestern wußte ich nicht, ob ich den Urlaub erhalten würde, darum habe ich nicht geschrieben.“
Vizza, bei der Ehrgeiz und leidenschaftliche Hingabe an ihre Dienstgeber einander übersteigerten, eilte mit vielen Schüsseln herbei und in ihrem mageren Gesicht stand der brennende Wunsch geschrieben, daß das sonntägige Essen Gnade vor den Augen des zugereisten Gastes finden möge. Miho holte Wein herbei, und während man mit Genuß und Andacht aß und trank und mit den Gläsern anstieß, flog Frage und Rede hin und wider. Ob man von den Geschwistern in Zara kürzlich Nachricht erhalten, wie es dem guten Valerio gehe, ob man über Adelaide und ihre Familie in Ragusa Erfreuliches gehört habe und was für Nachrichten Pave von Pero erhalte. Dazwischen sah Toni immer wieder nach den Kindern hin, rief ihnen scherzende Worte zu und erkundigte sich schließlich nach der Bedeutung der Kostümierung. „Ihr sollt wohl Dalmatiner sein? Woher seid ihr denn? Aus Obrovazzo? Aus Canale? Oder von den Inseln? Ganz ohne weiteres kann man es euch nicht ansehen.“ Die Kinder, die den Sinn dieser Frage nicht verstanden, blickten verlegen an ihren schönen Gewändern hinunter und dann hilfesuchend nach Miho. Dieser lachte.
„Ein wenig von allem ist dabei, so genau nehmen wir es nicht. Hier kann es auch niemand nachprüfen. Jetzt müssen wir übrigens bald aufbrechen. Zuerst wollen wir zu Frau Biba. — Vizza! Spring hinauf zur Padrona di Casa und frage, ob wir alle für einen Augenblick vorsprechen dürfen. Mein Schwager, der Herr Hauptmann aus Mailand, sei gekommen! Aber von den Kostümen sagst du nichts!“
Vizza lachte höchst verschmitzt und kam nach einer Minute mit der Botschaft wieder, Frau Biba erwarte die Gesellschaft mit Freuden und bitte zu einer Tasse schwarzen Kaffees.
Den Kindern waren die runden roten Käppchen aufgesetzt und Henkelkörbchen mit Konfetti, den winzig kleinen, bunten Gipskieseln, an den Arm gehängt worden, und Miho steckte seinem Söhnchen noch einen Dolch in den Gürtel. So gerüstet betraten sie Frau Bibas Stube und begannen sofort, diese sowie Car-lotta mit Konfetti zu bewerfen. Die beiden Damen täuschten bedeutende Angst vor und wichen mit vorgehaltenen Armen und unter Schreckensrufen in den Hintergrund des Zimmers zurück, bis der gefährliche Überfall sich in allseitige freundschaftliche Begrüßung und Vorstellung des Hauptmanns auflöste. Es fiel Pave auf, daß Frau Biba Toni mit sehr förmlicher Höflichkeit und geringerer Wärme behandelte, als sie sonst jedwedem Lebewesen, ganz besonders aber allen Angehörigen ihrer von ihr so hochgeschätzten Mieter entgegenbrachte. Als auf dem Umweg über die Cholera das Gespräch auf Mailand kam, wo die schreckliche Seuche nun endlich doch erloschen war, und Pave eine muntere Frage nach dem gesellschaftlichen Leben dort an den Bruder richtete, wurde sie mit Befremden gewahr, daß sowohl Frau Biba als auch Toni ablehnende Mienen aufsetzten, und der Bruder die Rede unvermittelt auf Kaiserin Eugenie brachte, die man wahrlich die schönste Frau von Europa nennen dürfe. Seine beiden Schwestern fielen ihm ins Wort. Die schönste Frau von Europa? Was ihm einfalle! Das sei doch ohne allen Zweifel die junge Kaiserin Elisabeth. Auch sei sie edel und hochherzig, Eugenie aber eine kokette und intrigante Person, was aus allem und jedem hervorgehe, das man über sie höre. Mit leisem Lächeln und mit einem Blick auf seinen Schwager gab Toni sich gesch'agen. Miho mahnte nun zum Aufbruch, er müsse mit seinen beiden Masken noch andere Häuser überfallen.
Glühend vor Erregung zogen die Kinder mit ihm ab, Toni blieb bei den Schwestern, und man setzte sich in Bepis Speisezimmer an den schweren Eßtisch, über den nun eine dunkle gestickte Decke gebreitet war. Bepi begann sofort Strümpfe zu stopfen, und als Toni lächelnd sagte: „Wie fleißig du bist!“ antwortete sie gleichmütig: „Erstens muß ich fleißig sein, sonst haben wir keine Strümpfe anzuziehen, und zweitens freut mich das Plaudern nicht, wenn ich keine Arbeit in Händen habe.“
Auch Pave hatte ihr Nähzeug geholt. Sie war bemüht, kirschrote Atlasschleifen auf zwei kleinen, roten Filzhüten zu befestigen. Sie legte das Band zur Probe an die Kappen der Hüte und hielt sie begutachtend von sich fort, so weit ihr Arm reichte.
Der Bruder sah ihr belustigt zu. „Pave putzt ihre Töchter heraus! Du hast recht, es sind reizende Kinder.“
„Auch hier in Motta sind alle Leute verliebt in die zwei kleinen Mädchen“, mischte Bepi sich ein. „Die Hausfrau würde sie am liebsten ganz bei sich behalten, so lieb hat sie die Kinder, und eine so strenge Frau sie sonst ist, Miliza und Cotia verwöhnt sie in jeder Weise.“
Toni lächelte. „Mit eurer Hausfrau ist, scheint's, nicht gut Kirschen essen, mir hat sie jedenfalls gleich ihre piemon-tesischen Krallen gewiesen.“
„Wieso piemontesisch? Sie ist eine Hiesige, die Familie soll immer im Venetianischen gewohnt haben.“
Nun lachte Toni auf seine stille Art. „So ist es nicht gemeint. Aber ihr Glaube, ihre Hoffnung und ihre Liebe sind, wie ich sehe, in Piemont. Für sie ist ein kaiserlicher Offizier, und gar einer aus Mailand, ein Gegenstand des Hasses. Oh, meine Guten, denkt ihr, ich kenne das nicht! Dieser kalte Haß, der ist in Mailand doch unser tägliches Brot. Denkt ihr, ich kenne das nicht, diese zurückhaltenden Blicke, den verhaltenen Hohn dieser kühl lächelnden Lippen, diese trotzige Haltung. Kennte ich sie nicht so gut, vielleicht wäre ich dann doch nicht ausgerechnet in den Tagen der Bälle und Feste aus Mailand geflüchtet.“
Ohne die letzte Bemerkung des Bruders zu beachten, sagte Pave eifrig: „Was Frau Biba betrifft, so irrst du dich ganz sicher. Ich kann dir gar nicht sagen, Toni, wie gut und fürsorglich sie gegen mich ist, und ich bin doch auch eine Offiziersfrau.“
„Gleichviel, du bist eben eine Frau, dir gegenüber ist sie warmer Mensch, Schwester, Mutter, mir gegenüber aber ist sie Anhängerin von Cavour, Revolutionärin, Hasserin.“
„Ah, Cavour!“ rief Pave, legte die fertig komponierte, mit Stecknadeln zusammengehaltene Schleife auf den Tisch und sah dem Bruder gespannt ins Gesicht. „Ah, Cavour! Von ihm haben sie doch damals bei Frau Bibas Abendgesellschaft so lang geredet.“
„Siehst du's! Cavour, das ist ihr Held, ihre Hoffnung, ihr Morgenstern. Von Cavour lassen sie sich auf die wilde Krim schicken, um im Bilde des russischen Sebastopol die Despotie zu bekämpfen, wie sie es nennen. Und dabei meinen sie Österreich.“
„Ach, Toni“, sagte Pave leise, „von allen diesen Sachen verstehe ich nichts. Wir in Dalmatien sind doch auch bei Österreich und wir wollen nicht weg von dort. Oder gibt es Leute, die weg wollen? Das Wichtige ist doch, daß man dort leben kann, wo man geboren ist, nicht? Ob ein deutscher Kaiser oder ein italienischer König über einen herrscht, ist das nicht gleich?“
Toni lachte, er rückte nahe an die Schwester heran und legte seine Hand auf ihren Arm.
Ja, ja, meine arme Pave, das sind schwierige Fragen. Du denkst an die Dinge, die einer Frau wichtig sind, und du hast recht. Ganz recht hast du. Du willst ein sicheres Heim, ein ruhiges Leben, du willst dich nicht von deinem Mann trennen und willst die Kinder friedlich aufwachsen sehen. Vielleicht ist es gut, vielleicht ist es eine Rettung für uns Männer, wenn die Frauen, oder wenigstens viele von ihnen, so denken wie du.“
„Siehst du, Pave, ich bin nun drei Jahre in Mailand, und das viele, das ich dort sehe, zwingt mich zum Nachdenken. Und zwar denke ich nicht nur über die Verhältnisse und über die Dinge nach, sondern auch,, und vielleicht am allermeisten, über mich selbst. Ich bin ein kaiserlicher Offizier. Wenn ich da so in Mailand herumgehe, dann habe ich immer das Gefühl, als wölbe sich über mir, unsichtbar, dort, wo der lombardische Himmel blaut, die alte, gewaltige und glorreiche Idee des österreichischen Staates. Unter meinen Füßen aber, verstehst du, Pave, da liegt braun und warm, greifbar und sichtbar, die lombardische Erde. Jahrhundertelang hat die österreichische Idee die Völker des mittleren, südlichen und östlichen Europa zusammengefaßt und;geführt: die Idee nämlich eines Reiches, in dem viele Völker, die sonst in Zwist und Armut und Schutzlosigkeit nebeneinander wohnen würden, gesichert beisammen leben können. Es ist eine heilige, eine ganz und gar glorreiche Idee, eine, für die zu sterben es wohl dafürstünde und für die auch viele, viele gestorben sind.“
Toni beugte sich näher zu ihr hin. Die
Völker aber, weißt du, Pave, die seit Jahrhunderten, so wie die verschiedenen Friedensschlüsse und Heiratsverträge sie zusammengeschweißt hatten, ruhig beieinander lebten, und die Vorherrschaft der Deutschen gern ertrugen, so wie Kinder das Regiment ihrer Eltern und ihrer Lehrer ertragen, sie sind nun gewissermaßen herangewachsen. Ich wenigstens deute es mir so. Was wir im Jahre Achtundvierzig überall erlebt haben, kam mir vor wie eine gewaltsame eigene Mündigkeitserklärung der Völker, verstehst du, Pave? Sie sind in ein neues Lebensalter eingetreten, sie stehen unter dem Zeichen eines anderen Gestirns. Sie wollen nun ihre eigenen Sprachen machen, und ihre Länder, die dem Kaiserreich eingegliedert sind, zu souveränen Staaten. Was gleichen Blutes ist, strebt zueinander. Ich sehe das alles ganz körperlich deutlich vor mir.“
Toni lehnte den Kopf einen Augenblick zurück. „Ach, meine Guten“, fuhr er mit eigentümlich vibrierender Stimme fort, „wenn man einsam ist und nicht sehr glücklich...“
Hier fielen ihm die Schwestern, die bisher achtungsvoll schweigend gelauscht hatten, leidenschaftlich ins Wort:
Toni, Toni, warum bist du nicht glücklich? Lieber, guter Toni, sag es uns! Was fehlt dir?“
Er lächelte sein freundliches Lächeln und sagte ruhig:
„Ihr guten Kinder, betrübt euch nicht um meinetwillen. Es ist nicht so wichtig, ob ein Mensch glücklich ist oder nicht, und Erkenntnis, das weiß ich schon lang, kommt nur aus Leid und Entbehrung. Aber laßt mich weiter reden.
Ich wollte vorhin sagen, daß jemandem, der, so wie ich, viel allein ist, Dinge deutlich werden können, die ein anderer vielleicht nicht sieht und fühlt; besonders dann, wenn das persönliche Schicksal mit dem allgemeinen Hand in Hand geht. Wenn zum Beispiel ein kaiserlicher Offizier ein Mädchen aus der guten Mailänder Gesellschaft lieben würde, sehr lieben, begreift ihr, und er wüßte mit jedem Tage deutlicher, daß seine Liebe ganz ohne Hoffnung ist, weil eine vornehme Mailänderin, wie die Dinge heute liegen, niemals die Werbung eines Österreichers annehmen wird: dann wird sich dieser Offizier vielleicht so lange fragen, warum kann ich die nicht erreichen, die mir mehr als alles auf der Welt bedeutet, bis er eine Antwort gefunden hat. Denn die scharfen und hellen Gedanken, die kommen ja aus der Qual des Herzens. Und die Antwort wird eben diese sein, daß ein kaiserlicher Offizier in Mailand heute der Vertreter jener alten und weisen Idee ist, eine Mailänder Frau aber die Vertreterin des neuen, starken, heißen Gefühls, das von dem Alten nichts mehr wissen will. Ja, dann sage ich mir selbst, die Zeit des übernationalen Reichsgedankens ist eben vorbei, und die Zeit des Nationalgefühls ist gekommen. In der Zucht und im Schutz unseres Reiches haben die Völker ihre Kinderstuben gehabt, nun wollen sie ihr Jünglingsalter in der Sonne ihres Freiheitsgefühls verleben. Und ich ahne, daß ihr Gefühl mit der Zeit so stark werden wird, daß es unser Vielvölkerreich, unseren Kaiserstaat und den Gedanken, den er verkörpert, zertrümmern wird. Ich fürchte es, und ich glaube es sicher. Aber, wißt ihr, ich frage mich oft, ob die Völker sich nicht später, in der Zeit ihrer Mannbarkeit, doch wieder irgendwie zusammenschließen werden? Dann wird dieses unser Österreich, so wie wir es heute kennen, nicht mehr leben, aber ein neues Reich, oder wie die Form dann heißen mag, wird die vielen wieder vereinigen, weil sie es nützlich finden werden, beisammen zu sein. Heute will das neue, warme Gefühl sein Recht, aber, wer weiß, in hundert oder in zweihundert Jahren wird der alte glorreiche Gedanke seine Kraft wieder gewinnen.“
„Was für ein Prophet du bist“, sagte Bepi bewundernd.
„Propheten sind immer dort erstanden, wo Leid und Liebe war. Schau, Pave, wir sind doch Italiener, und ich, sieh mich an, ich fühle mich trotzdem als Österreicher und spreche deutsch womöglich besser als meine Muttersprache. Vielleicht, weil ich als kleiner Bub schon in die Kadettenschule gekommen bin, vielleicht ist es deshalb, daß ich jetzt deutsch nicht nur spreche, sondern auch denke, und daß ich dieses ganze große kaiserliche Reich als mein Vaterland empfinde.“ Er sah die Schwestern lange an. „Ja, ich habe es lieb, unser Österreich. Aber ich liebe auch die Frau, warum soll ich es euch nicht beichten. Obwohl ich weiß, daß sie mir nicht bestimmt ist, gerade weil ich ein Österreicher bin und sie eine Mailänderin. Aus dieser doppelten Liebe heraus, begreift ihr es nun, sehe ich mehr als andere.“
Plötzlich unterbrach er sich:
Ach, die alte Scherel“ sagte er und griff in Paves Nähkram. „Die Kronenschere! Ich habe manchmal daran gedacht, wer sie bekommen haben mag, als Mama nicht mehr lebte.“
Er betrachtete das zarte Ding. Eine kleine Schere mit sehr kurzen Klingen, deren Ohren geschlossen eine Königskrone bildeten. „Die Kronenschere! Immer lag sie auf Mamas Nähtisch. Wißt ihr noch, was sie uns darüber erzählte?“
„Daß sie der armen Königin Marie Antoinette gehört hat“, sagte Pave. „Wie oft hat sie uns das gesagt. Mir schauderte immer beim Gedanken, daß sie die kleine Schere vielleicht während der Gefangenschaft im Temple bei sich gehabt hat.“ Pave ergriff sie und bewegte sie in der
Luft, als zerschnitte sie etwas. „Ich möchte sie nie verlieren, und wenn ich tot bin, soll Miliza sie bekommen!“
Draußen hörte man Lärm. Die Kinder kehrten zurück, die Gesichter voller Freude und Erregung. Sie stürzten sich sofort auf ihre Mutter und begannen ihre Erlebnisse zu erzählen. Langsam verschwand der Schmerz aus dem Gesicht des kaiserlichen Offiziers. Au dem Roman „Pave und Pero“, mit Bewilligung des Otto-Müller-Verlages, Salzburg