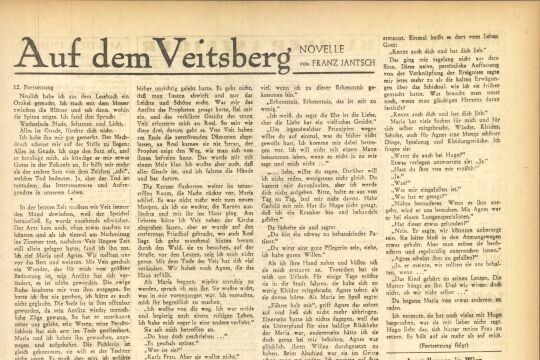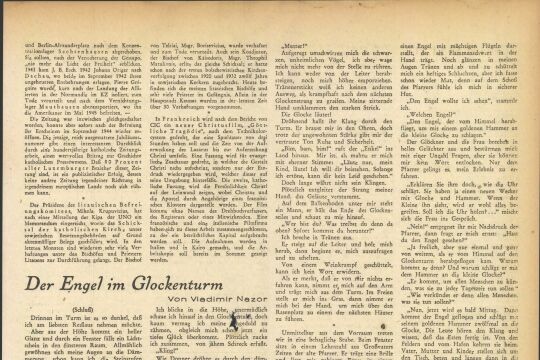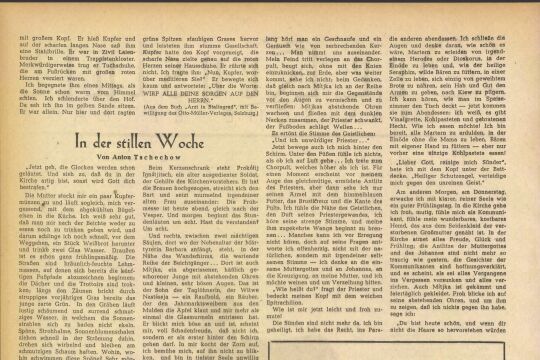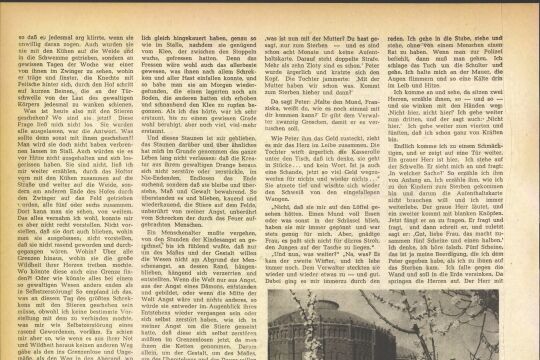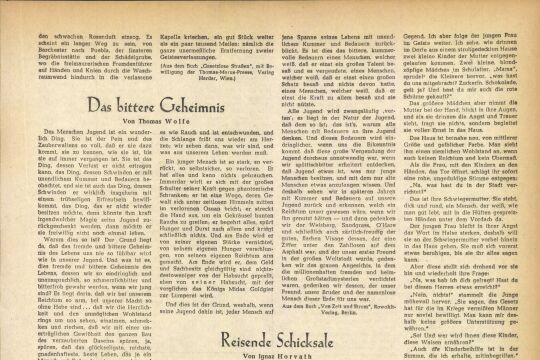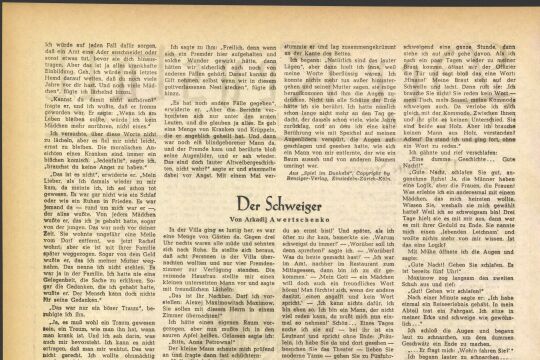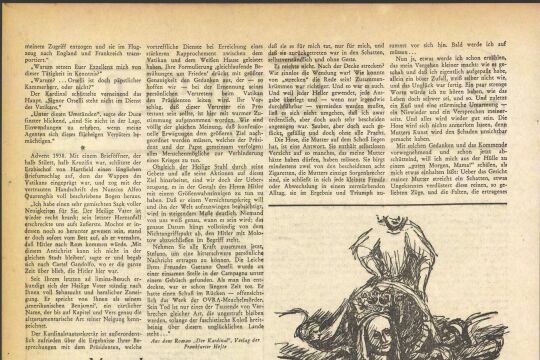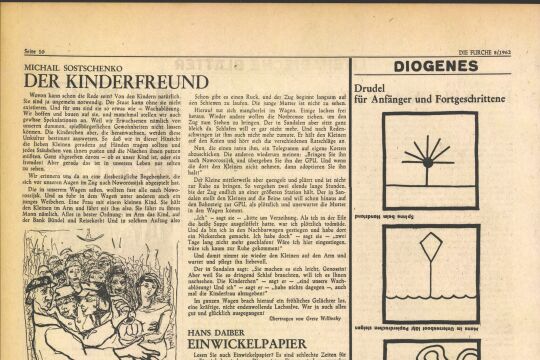Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Der Weg in die Freiheit
Der letzte Verhandlungstag gleicht dem Ende eines Boxkampfes, jenem entscheidenden Augenblick, da beide Rivalen ungeduldig darauf warten, daß der Schiedsrichter einem von ihnen als Sieger die Hand hochhalten würde.
Der letzte Verhandlungstag ist sehr kurz. Der Richter verliest das Urteil und dessen Begründung in winzigen zehn Minuten. Aber während du in der Zelle darauf wartest, zum Gerichtssaal gebracht zu werden, während dir der Aufseher auf dem Flur die Handschellen abnimmt, während du auf der Anklagebank herumrutschst, scheint die Zeit stehengeblieben zu sein.
Endlich treten die Richter durch eine Seitentür ein. Es sind fünf, der Vorsitzende und vier Beisitzer. Der Aufseher gibt mir ein Zeichen, daß ich aufstehen soll.
Die Ohren sausen, im Magen drückt ein Kloß. Mir fällt die beliebte Redensart ein: „Mir schlottern die Knie.“ Das ist reine Erfindung, Angst fühlt man nur im Magen und höchstens noch im Kopf, die Beine sterben ab.
Ich sehe den Verteidiger an. Er nickt mir liebenswürdig zu.
Der Staatsanwalt starrt vor sich hin. \
Welchem von den beiden wird der Richter die Hand geben?
Für einen Augenblick habe ich mich in die Rolle des Zuschauers versetzt, obwohl es um meine Haut geht.
Die Stimme des Vorsitzenden ist nicht angenehm, sie ist näselnd, widerlich. Ich kann ihn nur schwer verstehen. Ich höre nur einzelne Worte, aus Sätzen gerissen, die sich verlieren, von dem Abgründ verschlungen werden, der sich zwischen mir und dem Richtertisch auftut.
Der Vorsitzende legt das Papier, das er verlesen hat, vor sich auf den Tisch. Er nimmt die Brille ab, steckt sie ins Etui, legt es auf den Tisch, neben das Papier. Er setzt sich. Er lächelt.
Was bedeutet das? Der Verteidiger klopft mir auf die Schulter, drückt mir die Hand. Der Staatsanwalt sieht mich böse an. Der Vorsitzende öffnet den Mund, aber jetzt höre ich seine Stimme überhaupt nicht mehr. Was geht vor? Was ist los?
„Er ist noch heute aus dem Gefängnis zu entlassen.“
„Das wird leider nicht gehen, Genosse Vorsitzender,“, entgegnet der Aufseher.
„Warum nicht? Das Gericht hat ihn freigesprochen.“
Noch irpmer begreife ich nicht, was los ist.
„Weil im Gefängnis nur bis zwei gearbeitet wird. Ich meine, im Büro. Der Verwalter ist nicht mehr da. Im Magazin ist auch niemand.“
„Und wo ist der Verwalter?“
„Das weiß ich nicht.“ Der Aufseher zuckt verlegen die Schultern. „Wahrscheinlich zu Hause.“
„Rufen Sie ihn, telefonieren Sie, er soll sofort kommen.“
Der Aufseher führt mich aus dem Gerichtssaal. Der Verteidiger springt noch immer um mich herum, „Ich hab’ es gewußt, ich hab’ es gewußt“, wiederholt er immerzu.
„Heute nacht wirst du in einer offenen Zelle schlafen“, sagt der Aufseher. „Du bist frei. Morgen früh bekommst du deine Sachen zurück, dann kannst du nach Hause gehen .. .“
„Wieviel habe ich gekriegt?“ frage ich.
„Was wieviel?“
„Wieviel Jahre ich gekriegt habe.“ „Du bist freigesprochen, frei bist du, verstehst du? Frei. Du wirst in einer unverschlossenen Zelle schlafen, wie jeder freie Mensch.“
Ich grinse blöd.
Obwohl die Zellentür weit offen
stand, habe ich die ganze Nacht kein Auge zugetan. Vor Tau und Tag führt mich der Aufseher ins Büro des Verwalters. Er bringt mir Kaffee, schaltet das Radio ein. Jemand singt aus voller Kehle: Ventiquattro mila baci.. .
Der Verwalter kommt erst gegen acht. Ich muß eine Erklärung unterschreiben, daß ich keine Beanstandungen gegen die Behandlung im Gefängnis vorzubringen habe. Dann bringt mich der Aufseher ins Magazin. Dort werden mir Anzug, Wäsche, Schuhe, Überzieher, Geldbörse, Personalausweis, etwas Kleingeld zu- rückgegeben.
Der Verwalter drückt mir die Hand. Seine Handfläche ist feucht, der Druck schlaff.
„Viel Glück . . . viel Glück auf den Heimweg.“
Mein Zug geht erst um elf. Zwei Stunden habe ich noch Zeit. An der Ecke ist ein Bistro. Ich trete ein. Bestelle Kaffee.
„Mit Schlagsahne?“
„Bitte“.
Dieser Kaffee ist viel besser, das heißt stärker als der, den mir der Aufseher im Büro des Verwalters gegeben hatte. ,
Ventiquattro mila baci . .. Auch durch das Bistro dröhnt dieser Schlager. Vorhin schien er mir noch ein aufdringliches Geschrei, jetzt habe ich mich schon ein wenig daran gewöhnt.
Der Autobus ist fast leer. Der morgendliche Stoßverkehr ist scho.n vorüber, das Nachmittagsgedränge noch weit. Ich gebe dem Schaffner zwanzig Dinar, er sieht mich erstaunt an.
„Die Karte kostet fünfzig“, sagt er.
„Entschuldigung.“ Ich gebe ihm noch drei Zehner.
Auf dem Bahnhof geht es lebhaft zu. Reisende kommen und gehen, die meisten stehen auf dem Bahnsteig, in den Wartesälen, vor den Schaltern. Ich kaufe eine Zeitung, setze mich in eine Ecke des Wartesaals. Die fett gedruckten Schlagzeilen auf der ersten Seite berühren mich nicht, es ist, als berichteten sie über völlig unbekannte Ereignisse und Personen.
Mein Zug ist schon eingefahren. Ich steige in den ersten Wagen. Keine Seele. Noch eine halbe Stunde bis zur Abfahrt.
Es ist kühl im Abteil. Weil die Lokomotive noch nicht angekoppelt ist, sind die Heizungsrohre kalt. Trotzdem öffne ich das Fenster, es ist stik- kig, mir ist, als würde mir jeden Augenblick die Decke auf den Kopf fallen.
Ich blicke hinaus. Ein Milizionär geht vorüber. Er sieht sich nach mir um. Er kommt mir bekannt vor, auch an seinem Gesicht merke ich, daß er rätselt, wo wir uns schon begegnet sind. Für einen Augenblick bleibt er stehen, dann geht er jedoch weiter. Nach einiger Zeit kehrt er zurück, bleibt vor meinem Fenster stehen.
„Kennen wir uns?“
„Mir scheint, ja.“
„Gestern habe ich einen Zeugen aus dem Gefängnis zu Ihrem Prozeß gebracht, erinnern Sie sich?“
„Natürlich. Das war vorgestern, nicht gestern.“
„Und?“ „Was?“
„Wie ist die Verhandlung ausgegangen?“
„Gut, wie Sie sehen.“
„Der Zeuge, den ich brachte, hat Sie schwer belastet. Sind Sie entlastet worden?“
„Natürlich.“
Er glaubt mir nicht. Besorgt entfernt er sich. Bald kehrt'er lachend zurück. „Ich habe mich überzeugt“, sagt er. „Alles in Ordnung. Gute Reise.“
Am Fenster eilen die Telegrâfenma- sten vorüber. Die Stöße der Räder auf die Schienen lassen mich nicht einschlafen. Ich drücke mich in die Ecke, schließe die Augen. Ich ertappe mich dabei, wie ich automatisch den Schlagertext wiederhole: Ventiquattro mila baci,. . .
Vom Bahnhof nach Hause sind es zehn Minuten, wenn ich langsam gehe. An der Autobusstation stehen eine Menge Menschen, deshalb gehe ich einfach zu Fuß. War das nicht der... Nein. Ich habe mich geirrt. Der Mann ähnelt nur einem Dienstkollegen von mir, das heißt, einem ehemaligen Kollegen aus meinem ehemaligen Dienst.
Meine Wohnung liegt im zweiten Stock. Ich nehme jeweils drei Stufen. Ich läute. Nichts zu hören. Vielleicht ist niemand zu Hause. Doch. Ich höre Schritte sich nähern. Die Tür wird von einem schmächtigen kleinen Mädchen geöffnet.
„Mama ist nicht zu Hause.“
„Dein Vater.,.“
„Mein Vater auch nicht. Er arbeitet in Deutschland, schon zwei Jahre lang.“
„Ich bin dein Vater . . . Ich bin zurückgekehrt aus Deutschland.“
Meine Frâu und ich liegen im Bett, wach. Wir schweigen. In den nächsten dreißig oder vierzig Jahren werden wir uns unzähligemale alles erzählen, was uns jetzt am Herzen liegt.
Aus dem Radio dröhnt es: Ventiquattro mila baci. . .
„Gefällt dir Celentano?“
„Celentano? Wer ist denn das?“ „Der da singt. Heuer hat er in San Remo mit diesem Schlager den ersten Preis gewonnen.“
„Ja, er gefällt mir“, sage ich. Und bin sicher, daß er mir wirklich schon ein wenig gefällt.
Diese Erzählung ist dem Band „Himmel in Quadraten“ entnommen, der im Herbst im Styria-Verlag erscheinen wird.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!