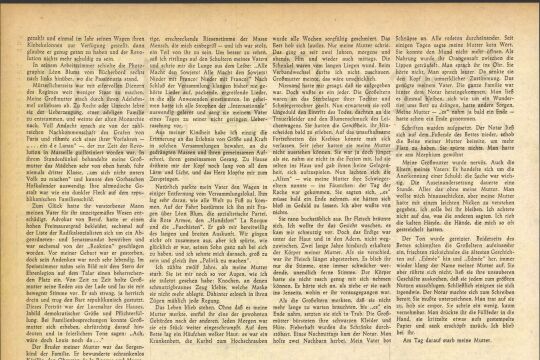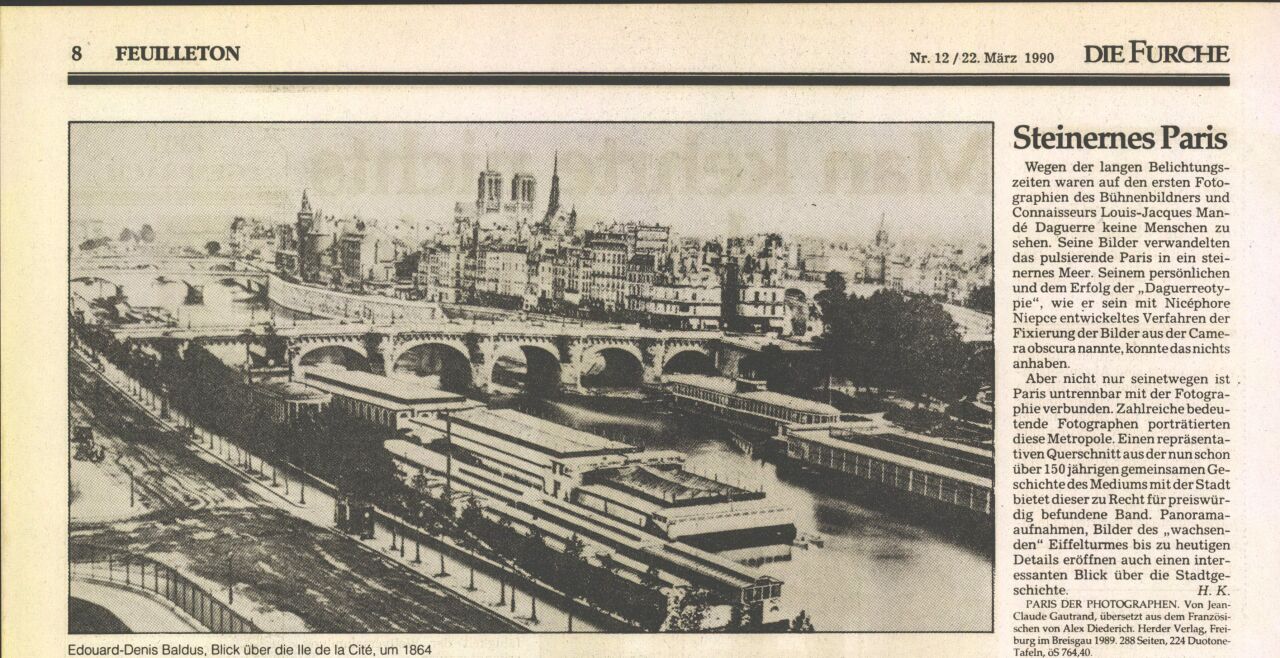
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Diese fetten Tenöre
Warum, fragte der Alte, ohne die Frage eigentlich an mich zu richten, die musikalische Welt es gerade den großen Sängern und Sängerinnen gestatte, mit ihren Körpern den liederlichsten Umgang zu pflegen, das hätte er doch einmal gern gewußt. Warum dürften Tenö- re zu Mülltonnen wuchern, warum Sopranistinnen zu Weinfässern werden? Glaube das Publikum viel- leicht, die Sängerkörper seien Re- sonanzkästen und brauchten ein großes Volumen zum besseren Klang? Wie vollkommen dagegen die Violine sei! Oder die Callas, Gott habe sie selig!
Und sei die Perfektion ihres Tons nicht in ihrer Form - j ener der Geige oder der Callas - schon vorwegge- nommen? Warum kaufe das musi-
kaiische Publikum seinen Lieb- lingssängern die Stimme denn ab, wenn nicht um der Schönheit we- gen? Aber warum seien die Men- schen es zufrieden, Schönheit nur zu hören, wenn sie dabei mit den Augen die abscheulichste Häßlich- keit sehen müßten? Sei das erste Gesetz der Schönheit nicht das Zu- sammenspiel der Elemente, die Har- monie des Ganzen? Wie könne schön klingen, was häßlich anzuse- hen sei?
Als Federico Piovani, der große Tenor, noch jünger gewesen sei, hätte er bei aller Schlankheit den- noch vollendet gesungen. Stimme sei also keine Frage des körperli- chen Volumens, soviel hätte Piova- ni selbst bewiesen. Dann sei das junge Talent entdeckt und geför- dert worden. In Italien, in Europa, in der ganzen Welt sei er schließlich bewundert und gemästet worden. Das Publikum mäste seine Lieb- linge.
Die Tenöre! Das Publikum werfe ihnen Bewunderung vor die Füße, bedecke sie mit Ro- senblättern und Anbetung. Und was gäben die Lieblinge zum Dank zurück? Wie danke ein Federico Piovani seinem Publikum? Er dan- ke ihm mit einem widerwärtig an- geschwollenen, ekelerregenden Körper. Er werde berühmter und fetter. Zwischen Ruhm und Fett bestehe der direkteste Weg. Piova- ni hätte den Applaus, der für seine Ohren bestimmt war, in den Bauch gesteckt. Er hätte ihn schlecht ver- daut. Er hätte erst achtzig, dann hundert, dann hundertdreißig, dann hundertfünfzig Kilo gewogen. Oder dreihundert Pfund, falls mir Pfund-
angaben geläufiger wären. Er singe und werde zum Monstrum.
Er zwinge das Publikum, sagte der Alte, vollendete Kunst mit Brechreiz zu paaren. Das könne nicht jeder, das erwarte nicht jeder. Federico Piovani singe noch immer das sogenannte lyrische Fach, zu dem seine Stimme ihn verdamme. Er maße sich die romantischen Liebhaberrollen an, auch heute noch, und er wälze sich dabei in die Domäne der Leidenschaften wie ein tödlicher Lavastrom in einen Fruchtgarten. Nicht anders, sagte der Alte, sei Pompeji untergegan- gen. Brutale Fülle auf feines Fili- gran. Caro Signore, beschwor mich der Alte, Sie dürfen dem Arien- abend nicht beiwohnen!
Federico Piovani verspotte die Kunst, der er zu dienen vorgebe. Liebte er sie, dann würde er ihrem Gesetz zu entsprechen suchen. Aber wie die Dinge nun einmal stünden - die Stimme des Alten war jetzt kaum hörbar -, was für ein grausiger,
übelriechender Mensch er doch geworden sei, dieser Piovani Fede- rico, wenn man von seiner Stimme einmal absehe. Wie unglücklich diese Stimme in einem solchen Körper sein müsse! Und genau besehen rieche auch sie schon! Sie lebe nicht ungeschoren im räudi- gen Körper, der applausumdonnert
- auch der Beifall sei eine Kloake -, auf den Bühnen der Welt stehe und sich selber anekle.
Federico Piovani wisse genau, daß die Agenten und die Sän- gerkollegen ihn nur noch mit Wi- derwillen umarmten. Er wisse, daß die Frauen, mit denen er sich umge- be, mit ihm nur seines Ruhmes und seines Geldes wegen verkehrten. Er wisse, daß jede, die zu ihm sagte: ich liebe dich, notwendigerweise eine Lügnerin sei. Weder bei Tisch noch im Bett finde der große Tenor
- es bedürfe keiner auch noch so ge- ringen Einbildungskraft, sich der- lei auszumalen -, die rechte Posi-
tion, sagte der Alte, ohne daß seine Stimme dabei den geringsten An- strich der Bosheit oder des Spottes gezeigt hätte, denn die rechte Posi- tion finde Piovani ja selbst auf der Bühne nicht länger. Die weltbe- rühmtesten Regisseure bemühten sich, den geeigneten Auftritt und den möglichen Abgang für Piovani zu schaffen, aber: es sei umsonst, die Regie werde damit nicht länger fertig, sie leiste nur noch Schützen- hilfe, sie sei bestenfalls die Ver- schleierungskomplizin eines großen Jammers und einer gewaltigen Niedertracht.
Federico Piovani wisse, daß seine Zukunft an dem handtuchgroßen Schweißtuch hänge, ohne das er seit Jahren nicht singen und leben könne, und an der Parfumflasche natürlich auch, am besonders ge- ruchintensiven Givenchy Gentle- man, - wie jedem Bürger dieser mit Piovani aufs engste vertrauten Stadt bekannt sei -, das der große Tenor in Literflaschen über seinen
Leib gieße. Piovani wisse auch, daß die teuersten Fracks der besten Schneider und die Kostüme der Opernhäuser durch Trocken- oder Naßreinigung kaum mehr sauber zu kriegen seien, weil er, der sie tragen müsse, nur noch aus Schweiß bestehe, aus einer widerlichen, gel- ben, ätzenden Flüssigkeit, die ohne Unterlaß seinem Körper entströ- me. Er erspare mir, sagte der Alte, den Hinweis auf die chronischen Stoffwechselstörungen der Dicklei- bigen, den Hinweis auf die explo- sionsartigen Koliken solcher Men- schen, die Erwähnung der nur noch eingeschränkten Fähigkeit, sich in diesem peinlichsten aller Punkte korrekt zu benehmen. Er rede nicht vom Verschleiß der entsprechen- den Muskulatur, die, wie alles übri- ge an einem solchen Körper, nur noch aus Fettgewebe bestehe. Dies alles lasse er unerwähnt.
Aber, und jetzt sprach der Alte .wieder laut und ohne Vorbe- halt, wir wüßten auch, daß für eine kurze Weile Federico Piovanis Stimme nur noch schöner klingen werde und, auf die schmale Distanz - aber immerhin! - von den Büh- nenbrettern zu den ersten Parkett- reihen der Kritiker oder zu den willfährig-korrupten Mikrophonen der Schallplattenfirmen um jeden Preis überzeugen müßte. Nur den großen Tenor selber überzeuge sei- ne Stimme nicht mehr. Im Vorge- fühl des großen Bankrotts lasse er sich gehen und setze sein Schwerst- gewicht als ein letztes Zeichen. Seine Masse bedeute ja auch, daß er seiner Kunst nicht vertraue. Im Vorgefühl des nicht allzu fernen Tages, an dem er nur noch aus geist- losem Stoff bestehen werde, kas- siere Federico Piovani Abend für Abend zur großen Rache an der dünneren Welt seine fetten Hono- rare ab.
Und ich dürfe nicht glauben, fleh- te der Alte, daß er den Sänger ver- achte oder gar hasse. Das Gegenteil sei der Fall, er liebe den singenden Sohn der Stadt, er liebe ihn über alles. Nur die Liebe sehe klar, nur sie erkenne die Gefahrenzeichen, nur sie spreche sie aus. Weil er, der Alte, die Kunst liebe, weil er Fede- rico Piovani liebe, müsse er ihn mit Worten, niemals aber mit dem Herzen, vernichten. Er müsse sei- nen Arienabend meiden, weil er nicht ansehen könne, wie der Ge- liebte dem Tod verfallen sei. Er halte sich abseits aus Zärtlichkeit, be- tonte er, und ein bitterer Zug schrieb sich in sein greises Antlitz.
„Ich flehe Sie an“, er legte mir seine rechte Hand auf den Arm, „gehen Sie nicht zum Arienausver- kauf!“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!