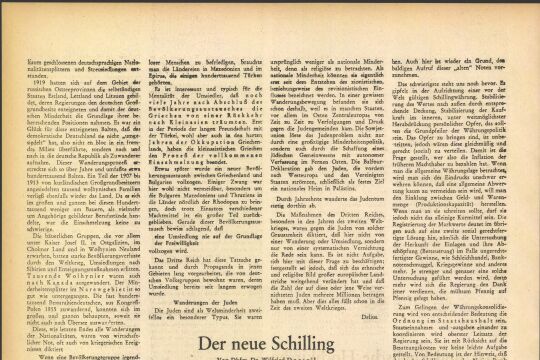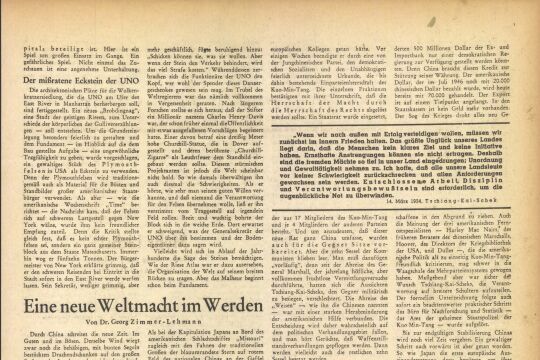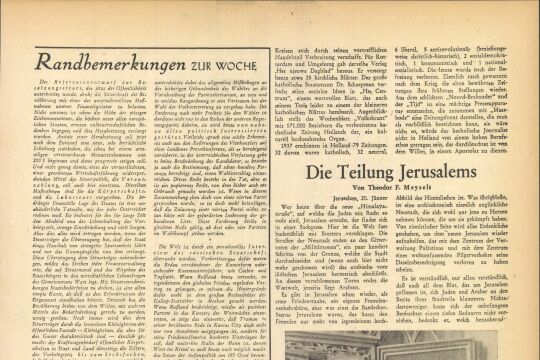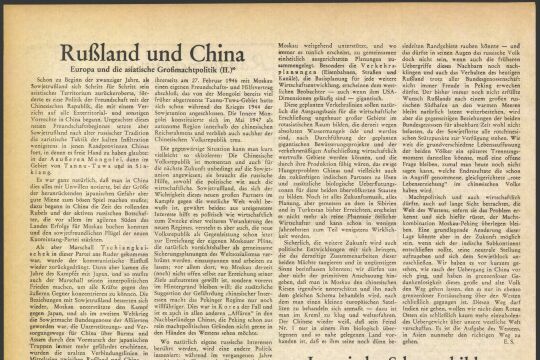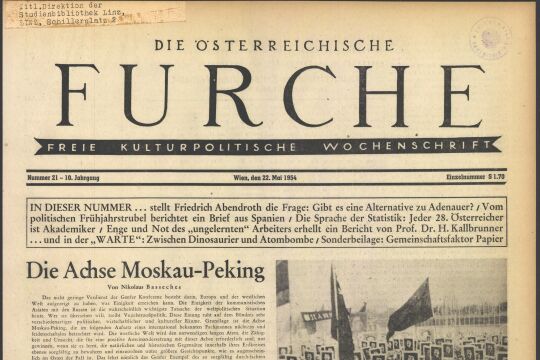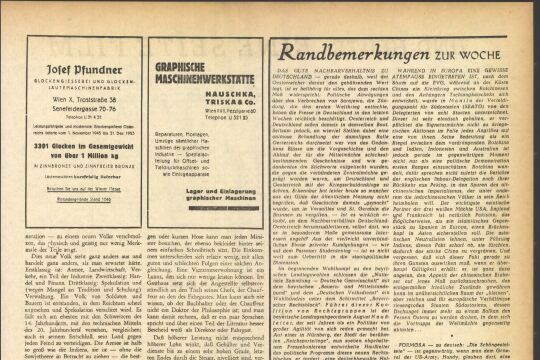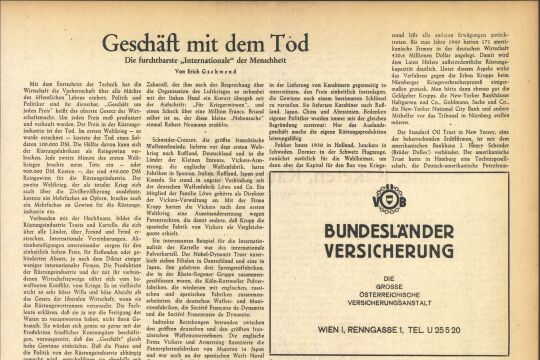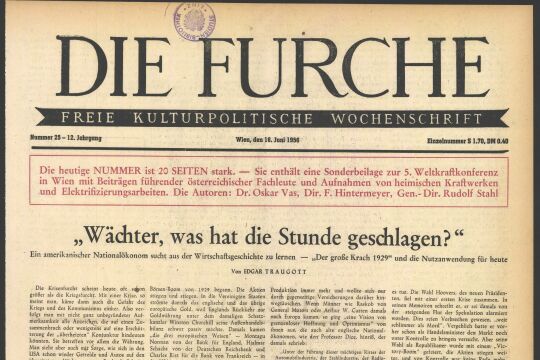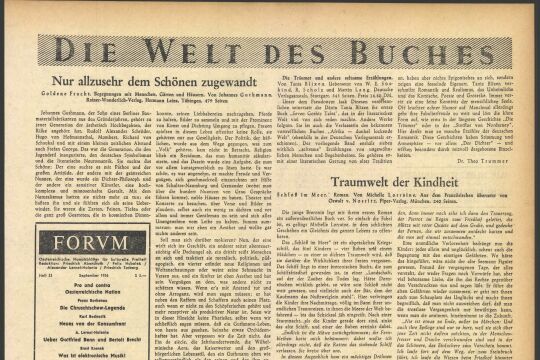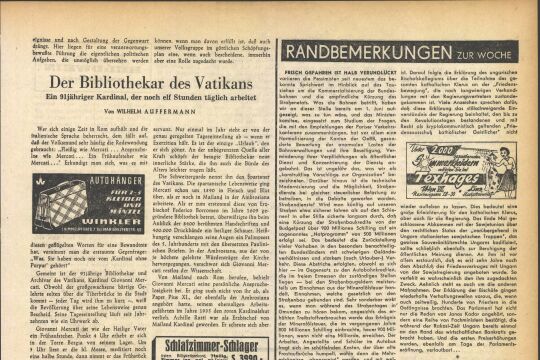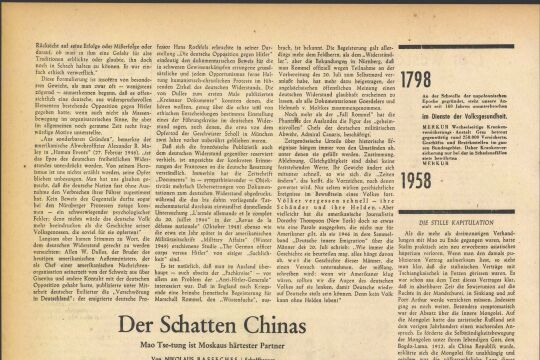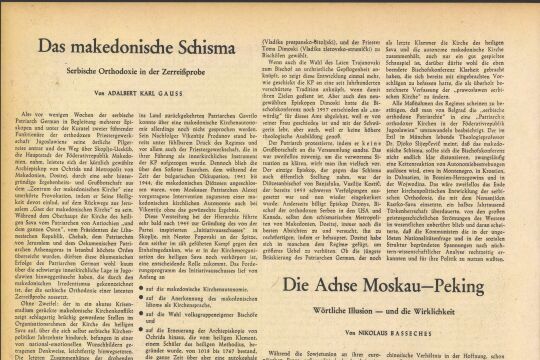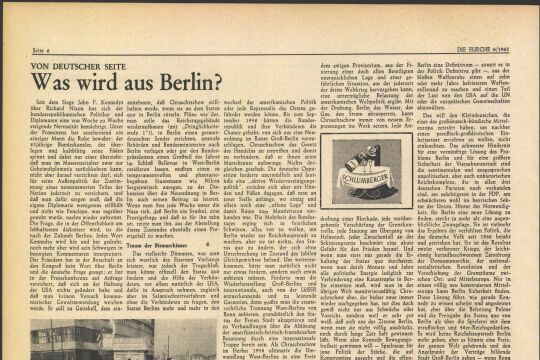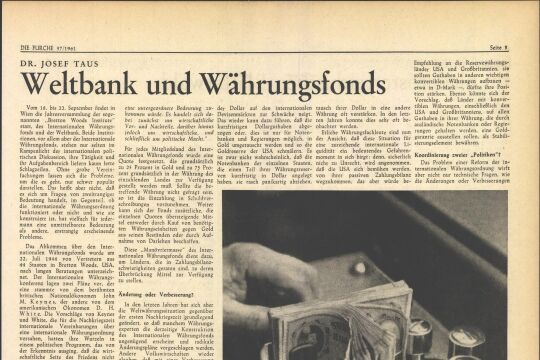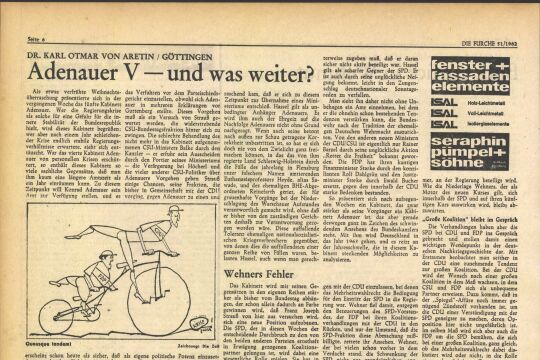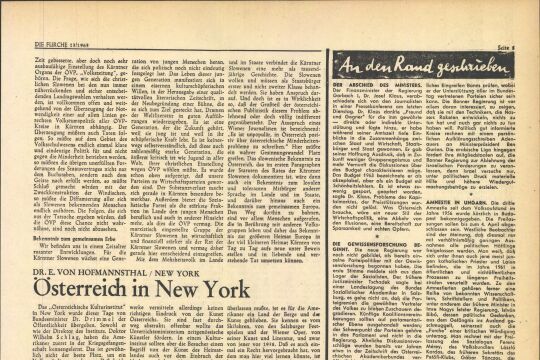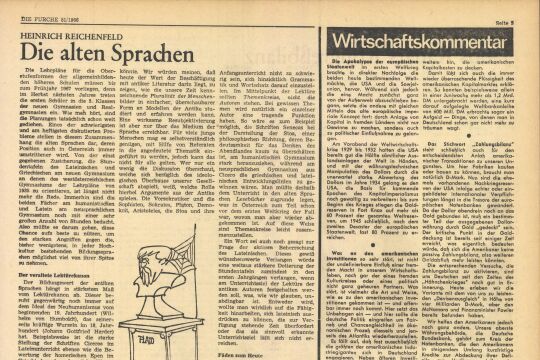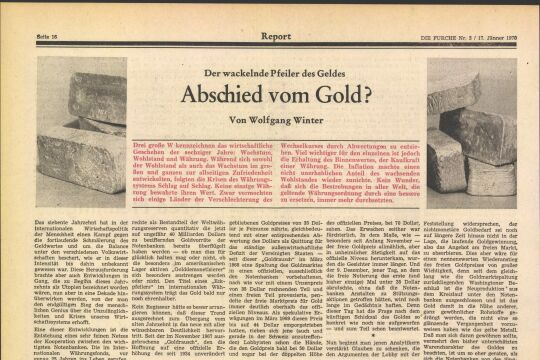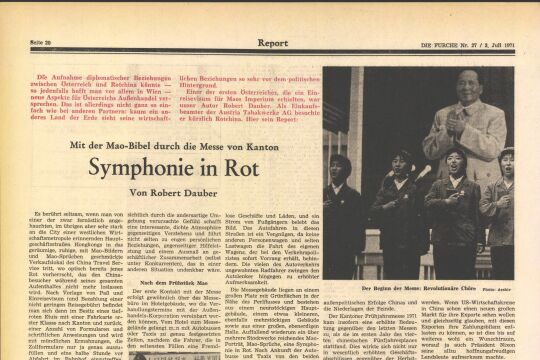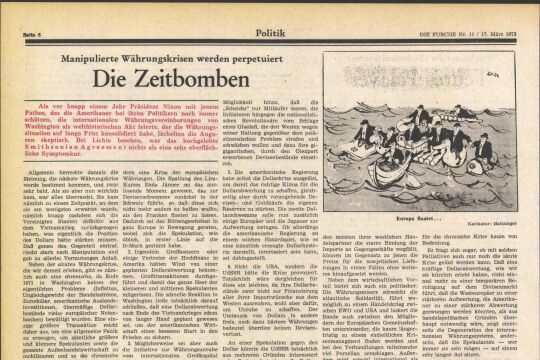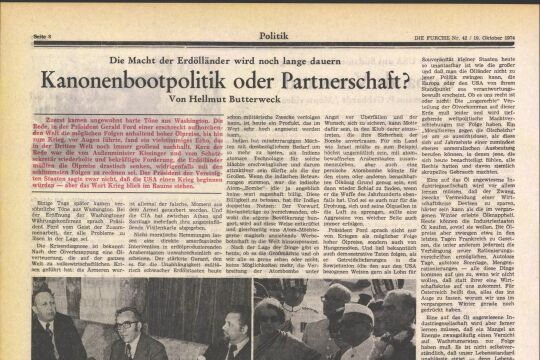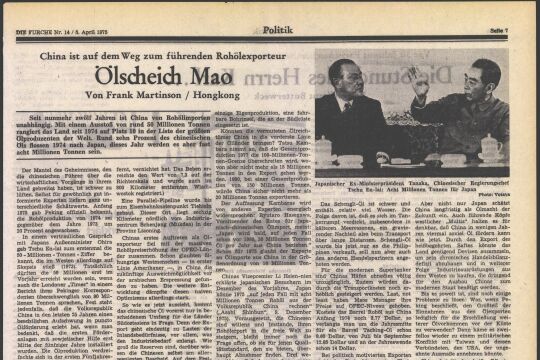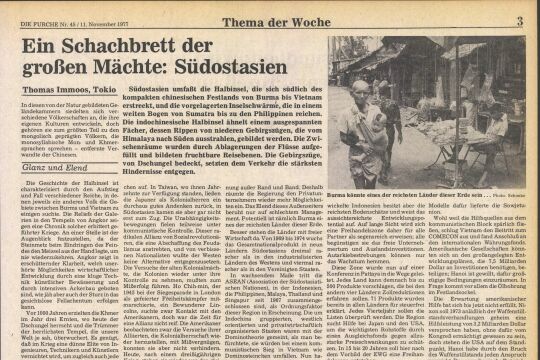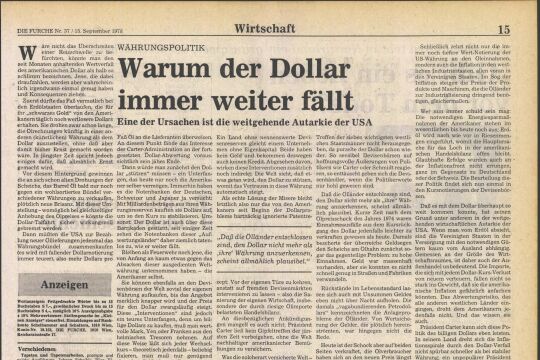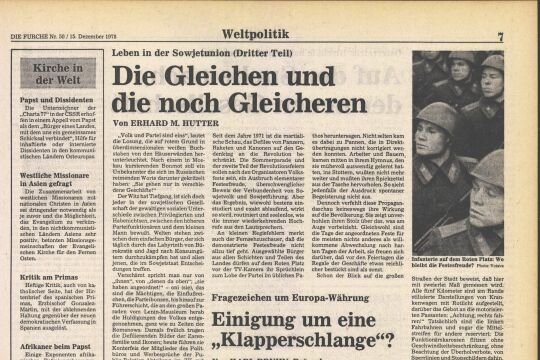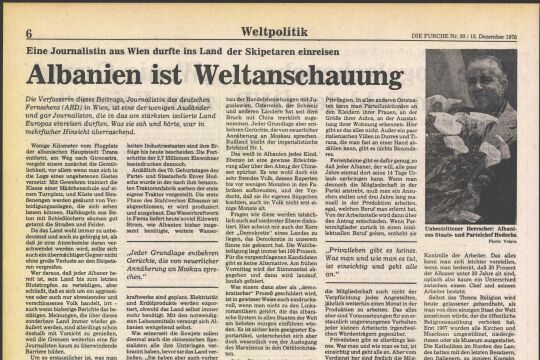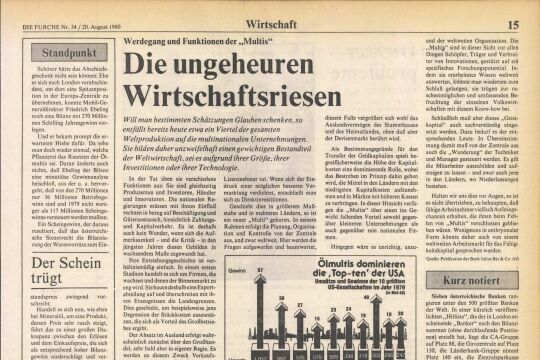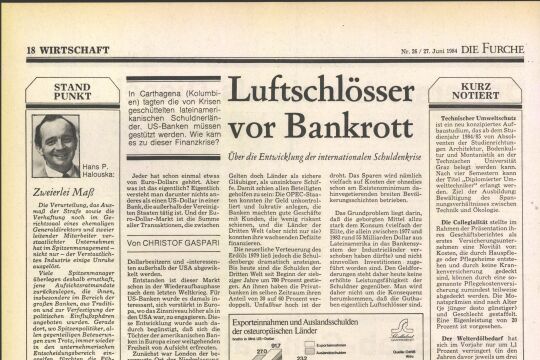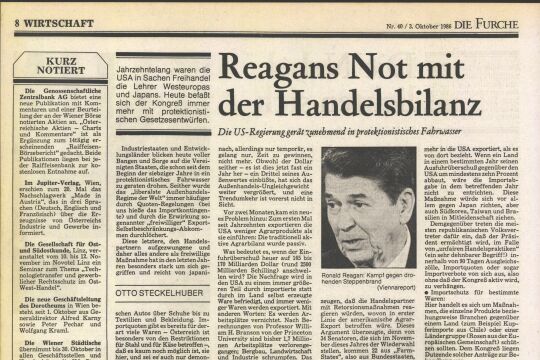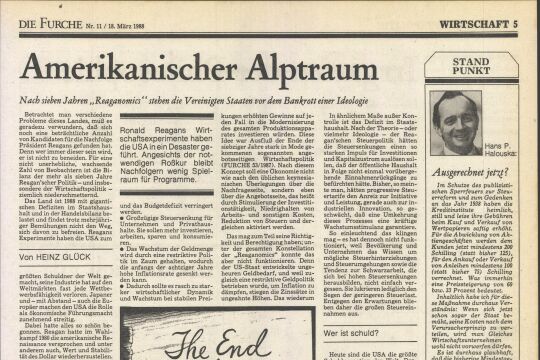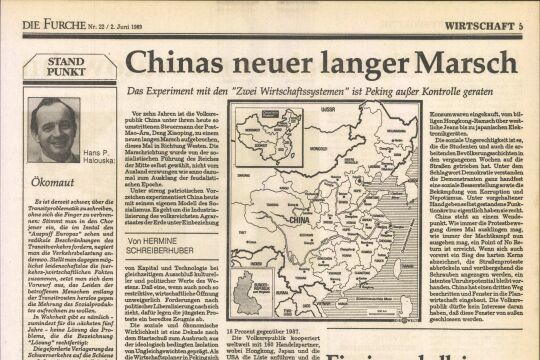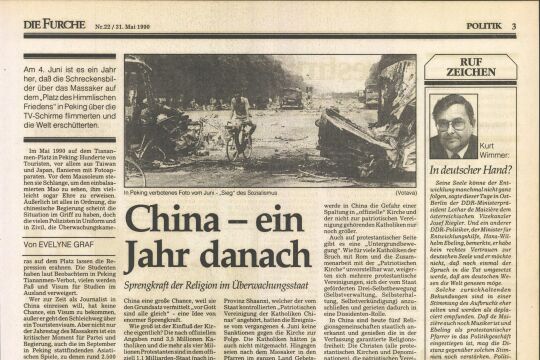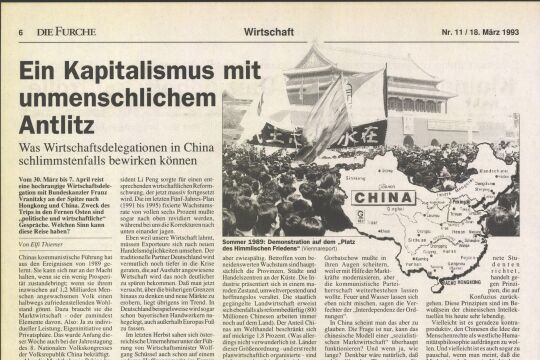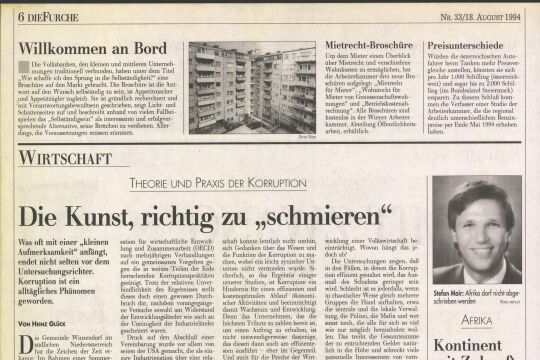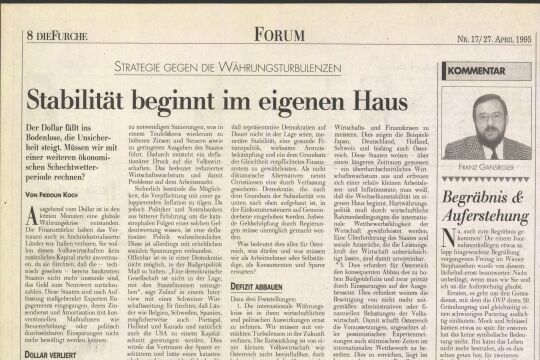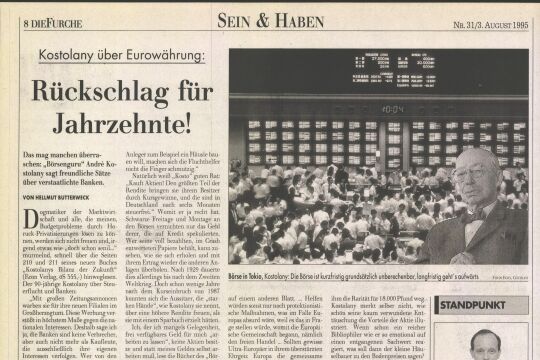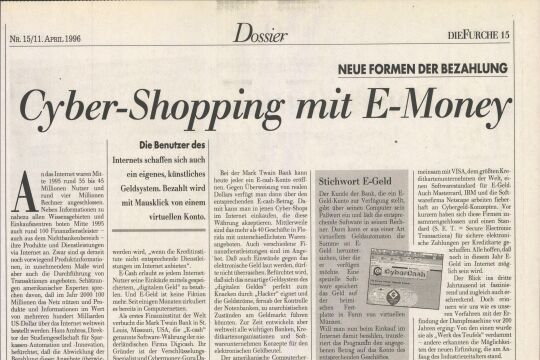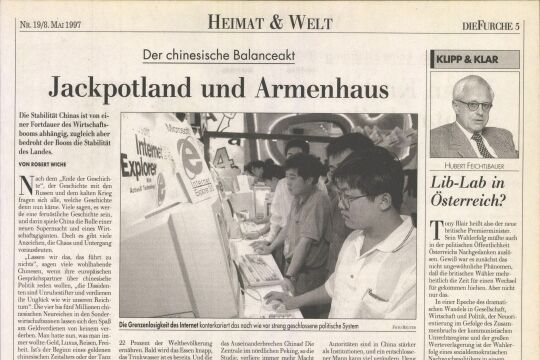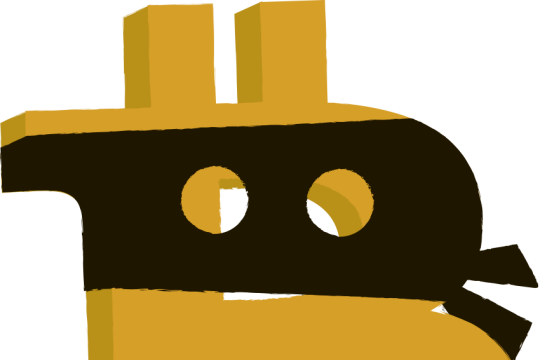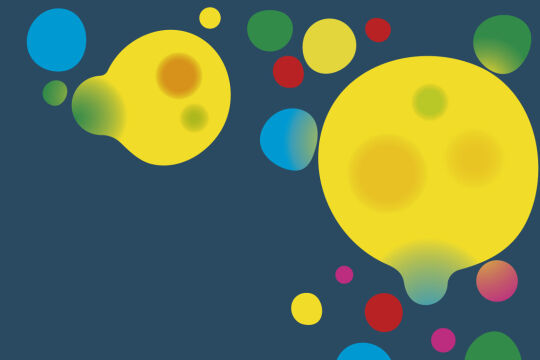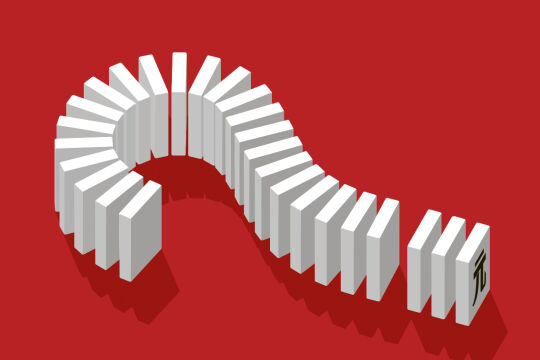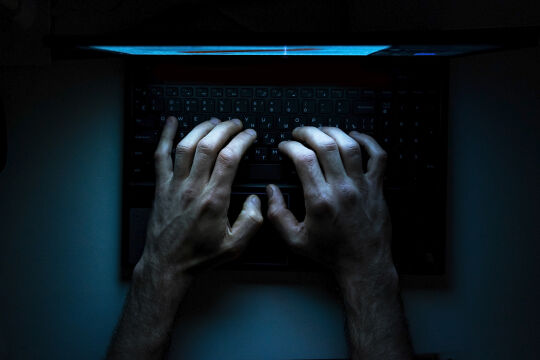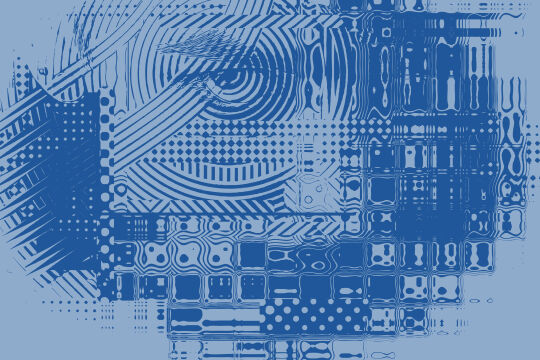Die Angst vor der Inflation
DISKURS
Digitalwährungen: Chinas Krypto-Vision
China geht nicht nur gegen Bitcoin vor, es forciert auch den Aufbau seiner eigenen Digitalwährung. Damit könnte es nicht nur seine Bürger überwachen, sondern auch den Dollar angreifen.
China geht nicht nur gegen Bitcoin vor, es forciert auch den Aufbau seiner eigenen Digitalwährung. Damit könnte es nicht nur seine Bürger überwachen, sondern auch den Dollar angreifen.
Als der venezianische Händler Marco Polo im 13. Jahrhundert nach China reiste, stieß er auf ein Zahlungsmittel, das in Europa gänzlich unbekannt war: Papiergeld. In fast allen Kulturkreisen war es bis ins Mittelalter üblich, Güter zu tauschen oder mit Gold-, Silber- oder Kupfermünzen zu bezahlen, deren Metallwert gleichsam den Geldwert darstellte. Das war allerdings nicht sehr praktisch, weil Händler ganze Wagenladungen an Münzen transportieren mussten. Obendrein führte es zu Rohstoffknappheiten. In China waren daher schon in der Song-Dynastie um das Jahr 1025 Wechselbescheinigungen (jiaozi) im Umlauf.
Fasziniert notierte Marco Polo in sein Reisebuch: „Von Zweigen der Maulbeerbäume wird Papier gemacht, das bis auf die kohlenschwarze Farbe, dem aus Baumwolle hergestellten völlig gleicht. Es wird nun in rechteckige Stücke verschiedener Größen zerschnitten – je nach dem Wert, den es haben soll. Dann kommt das Geld zum obersten Münzmeister, und dieser taucht nun das ihm anvertraute Siegel in Zinnober, und stempelt alle Scheine damit.“ In den Münzanstalten verstünde man sich auf die alchemistische Kunst, „Geld zu machen“. Nachdem es zu einem Abfluss von Kupfermünzen kam, warfen die mongolischen Herrscher immer häufiger die Druckerpresse an – und stürzten das Reich in eine schwere Inflation.
Währungs-Lotterie
Heute wird Geld nicht mehr aus Maulbeerbäumen, sondern aus Baumwolle hergestellt, und die Notenbanken drucken noch immer jede Menge Geld. Doch ausgerechnet in China, wo das Papiergeld seinen Ursprung hat, könnte das Bargeld bald verschwinden. Die Zentralbank in Peking arbeitet an einer eigenen Digitalwährung, dem E-Yuan. Erste Testläufe sind bereits erfolgt: Im Rahmen einer Lotterie wurden zehn Millionen Yuan, rund 1,3 Millionen Euro, an 50.000 Bürger ausgeschüttet. Das Geld konnten sie über eine App bei teilnehmenden Händlern ausgeben. Bei den anstehenden Olympischen Winterspielen in Peking sollen auch Besucher, die kein chinesisches Bankkonto besitzen, die neue Währung testen können. Im Reich der Mitte werden schon heute die allermeisten Geschäfte über mobile Bezahlapps wie Alipay oder WeChat Pay abgewickelt. Selbst Garküchen und Taxifahrer akzeptieren kaum noch Bargeld.
Zwar planen auch andere Zentralbanken wie die EZB die Einführung eigener Digitalwährungen. Doch die autoritäre Staatsführung in Peking kann wie keine andere Druck auf Händler ausüben, die neue Währung zu akzeptieren. Und deshalb schauen Analysten genau nach China, ob sich der E-Yuan zu einer neuen Leitwährung entwickelt. Manche Beobachter vermuten, dass mit der neuen Digitalwährung die Vormachtstellung der Bezahlplattformen in China gebrochen werden soll – was einer gewissen Logik folgen würde, weil die Regulierung von Tech-Konzernen zuletzt verschärft wurde. Andere befürchten, dass Peking eine beispiellose Überwachung ins Werk setzen könnte: Mit einem elektronischen Zahlungssystem könnte der Staat das gesamte Ausgabeverhalten seiner Bürger kontrollieren.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!