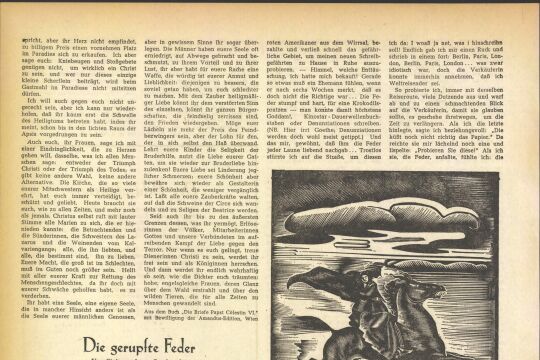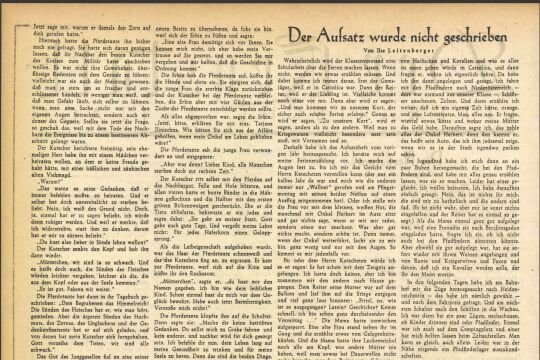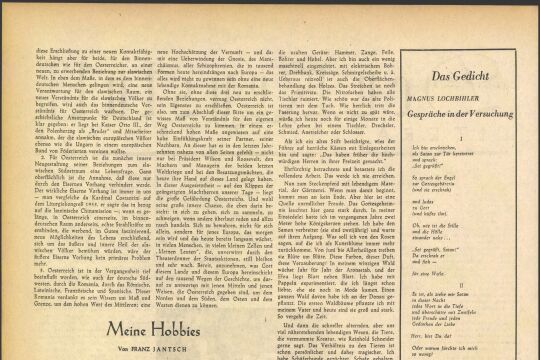Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die spitze Feder
Wir Schreiber werden von Leuten anderer Fächer beneidet um unser geringes Werkzeug. Was braucht ein Bildhauer nicht alles an Material und Werkzeug und uns genügt Feder, Tinte und ein Stück Papier. Das andere tragen wir alles in uns. Ich will nicht von der Tinte und dem Papier sprechen, obwohl sich viel Schönes und Wichtiges darüber sagen ließe, ich will nur von der Feder reden.
Ich liebe meine Feder. Es ist mir ein Genuß, sie in die Hand zu nehmen und wenn mir etwas eingefallen ist, sie über das Papier gleiten zu lassen. Ich kann nicht sagen, daß ich mit einer einzigen Feder schreibe, nein, ich habe verschiedene. Ich kann mir nicht vorstellen, wie einer alles mit der Maschine schreiben kann. Es soll Leute geben, die schreiben sogar ihre Gedichte damit. Manche Dichter, besonders amerikanische, sind von ihrer Maschine nicht zu trennen und schleppen sie überall herum. Fällt ihnen zum Beispiel auf der Wiese ein Gedicht ein, so setzen sie sich mitten hinein, legen die Maschine auf die Knie und klappern drauflos. Ich besitze auch eine und könnte eine lange Geschichte von ihr erzählen, aber ich hasse das Geklapper. Für einen Geschäftsbrief („Auf Ihre Anfrage erlaube ich mir höflich mitzuteilen, daß...“) oder für einen Akt (..Protokoll, aufgenommen in Gegenwart des Herrn...“) ist sie gut zu verwenden; besonders wenn man sorgfältig schreibt, aber etwas Persönliches zu schreiben, da braucht man • doch die Stille, wie sie uns die Feder gewährt.
Ich habe schon alle möglichen Federn versucht. Ich finde, die primitivsten sind die besten. Ich bin zu den weißen Stahlfedern der Kindheit zurückgekehrt. Man schreibt damit klar und fein, und die Haar- und Schattenstriche (ich habe Schläge in der Schule dafür bekommen) lassen sich wohl unterscheiden. Vielleicht kommt manches spitze Wort, das mir so angekreidet wird, von dieser spitzen Feder? Wenn man mit einer spitzen Feder auf glattem Papier schreibt, oh, das geht dahin wie auf dem Eislaufplatz, wo es auch bald einen Zusammenstoß oder wenigstens einen Anstoß gibt.
Eine Zeitlang schrieb ich — zweifellos ein Atavismus — mit einem Gänsekiel. Er hat viel für sich. Man schneidet ihn si'h ^urecht, wie er einen am besten zur Hand steht. Die Feder gibt nach, das Gefieder umkost beim Schreiben den Handrücken und verleiht etwas Beschwingtes. Ich habe den Gänsekiel auch in der Kanzlei benützt, bin aber wieder davon abgekommen, weil man wegen solcher Kleinigkeiten gleich in Verruf kommt. Solche kleine Absonderlichkeiten wirken unglaublich aufreizend.
Mein Großvater hat übrigens den Übergang von dem Gänsekiel zur Stahlfeder noch erlebt und mir erzählt. Er ging damals in die Schule, das heißt, richtige Schule war es nicht, der alte Dorfschneider machte sich ein Nebengeschäft, in dem er die Kinder im Lesen und Schreiben unterrichtete. Streng sah er darauf, daß die Federn schön gespitzt und den richtigen Schlitz hatten. Damals tauchten auf den Jahrmärkten die ersten englischen Stahlfedern als sensationelle Neuigkeiten auf. Mein Großvater war so fortschrittlich (vielleicht habe ich das geerbt), daß er sich eine erstand, und damit in die Schule kam. Mehr brauchte er nicht. Der Schneider riß sie ihm aus der Hand und zerbrach sie vor seinen Augen. Nur wurden auch die andern Kinder darauf aufmerksam und der Kampf um die Federn begann. Der Schneider schlug die Kinder für diese Neigung zum Fortschritt unbarmherzig, er sagte, mit der feinen Schrift werden sie sich die Augen ruinieren, und die Stahlfedern werden sich nicht durchsetzen (worin er sich als schlechter Prophet erwies). Der Schneider selber probierte die neuen Federn nicht einmal. Mein Großvater steckte sich die Stahlfeder in den Gänsekiel hinein und schwindelte so. Als er einmal krank war, besuchte ihn sein Lehrer (welcher reformierte Lehrer tut das heute?). Er trat ans Bett heraa und spuckte ihn kräftig in die Augen. Der Knabe — mein Großvater — war darüber empört, denn es grauste ihm von dem Speichel des alten Mannes, aber er sagte nichts. Das Anspucken war gut gemeint und ist bekanntlich ein alter Heilzauber. Dann setzte sich der Schneider gemütlich aufs Bett und fragte: „Na, Karl, wie geht's dir?“ Und Karl konnte ihm nicht mehr böse sein und wischte 6ich die Augen trocken. Im Laufe des Gesprächs sagte der Alte: „Es wäre mit dir ganz gut zum Auskommen, wenn nicht die verfluchten Stahlfedern dahergekommen wären.“
Ich mache hier die Reflexion auf mich. Ob nicht der selige Großvater doch fortschrittlicher war als ich, da ich zu seiner damals neuen Stahlfeder zurückkehre, anstatt mit dem modernsten Schreibgerät, Diktaphon mit Schreibmaschine gekoppelt — man soll bald damit fertig sein — zu liebäugeln.
Als ich in die Schule ging, war meine erste Feder die weiße Stahlfeder des Großvaters, und jetzt ist sie mir wieder die liebste. Ich habe viele andere Federn probiert, englische, amerikanische, stumpfe, schräge, breite, aber das ist alles so ausgefallenes Zeug, das keinen Wert hat. “
Natürlich habe ich auch eine Füllfeder, eine gute sogar, sie hat — alte Leute merken sich den Preis — im Jahre 1937 achtzig Schilling gekostet. Ich habe sie nicht auf einmal gekauft. Zuerst nahm ich eine billigere. Da sie mir nicht zur Hand stand, ging ich wieder in den Laden in der Währinger Straße, und der gutmütige Verkäufer tauschte sie mir, versteht sich gegen Aufzahlung, in eine teurere um. Nachdem ich das mehrmals getan hatte, kam ich auf die zweitbeste seines Lagers, die ich jetzt noch habe. Der Verkäufer hat mir damals gesagt, je größer die Goldfeder, um so besser schreibt man. Er hätte eine noch größere gehabt, ein herrliches Stück, deren Feder fast so groß war wie der kleine Finger. Aber der Preis war entsprechend. „Wer kauft so etwas? fragte ich. „Vom Generaldirektor aufwärts“, antwortete er.
Die Feder von damals habe ich heute noch, genau gesagt, die Goldfeder; das einzige Stück Gold übrigens, das ich habe, außer einem Goldzahn, dem Geschenk eines Wohltäters. Ich fuhr mit der“ Feder im 15er-Wagen durch die Gudrunstraße, plötzlich bremste der Fahrer, ich fiel nach vorne und brach die Feder entzwei. Ich war unglücklich und verlangte Ersatz von der Gemeinde Wien, städtische Straßenbahnen, wurde aber abgewiesen. Ich hätte mich anhalten sollen, dazu seien die Halteriemen da. Das Unglück war nicht so arg, wertvoll bei einer guten Feder ist nur die Spitze, wie der Verkäufer gesagt hat, das schwarze Zeug, das Gehäuse, kostet nicht viel und kann leicht ersetzt werden.
Mit dieser Feder habe ich etliche tausend Seiten geschrieben. Zwei Liter Tinte beiläufig hat sie konsumiert. Mit Tinte — ich erwähne es nur nebenbei — ist sie unglaublich sparsam. Als ich die letzte Flasche kaufte, marschierte Hitler eben in Jugoslawien ein. Mir graut, wenn ich denke, was noch geschieht, bis sie zu Ende ist. Sie hat bereits zwei Gebrechen.
Erstens ist die vorderste Spitze verbogen und der Tintennachfluß stockt, so daß ich nach hundert Worten eintauchen muß. Jeder andere, der mit ihr zu schreiben versucht, legt sie fluchend alsbald weg. Aber die Leute haben keine Ahnung, was für ein gutes Stück sie ist. So ein Stück wächst einem zu wie das Schicksal, man kann nicht alles so leichthin ändern. Und wo kämen wir hin, wenn man sich alles am bequemsten einrichtete. Jahrelang nehme ich mir vor, sie reparieren zu lassen, aber ich bin noch nicht dazugekommen, und die Federreparatur belastet mich ebenso wie vieles andere, das ich immer hinausschiebe. Also ich tauche die Füllfeder ein und dann schreibe ich eine Weile. Deswegen ist es doch eine Füllfeder. Gesicht hat das keines, was ich mit dieser Feder schreibe. Die wenigsten können es überhaupt lesen. Wenn ich aber schön schreiben will, greife ich nach der weißen Stahlfeder. Damit kann man nämlich zum Unterschied von den Füllfedern Haar-und Schattenstriche machen, die Voraussetzung jeder Kalligraphie.
Das Schönschreiben ist streng genommen schon ein anderes, wenn auch verwandtes Kapitel. Darüber ließe sich viel sagen. Ich liebe eine schöne Schrift und sehne mich danach. Ich bin überzeugt, wenn ich schöner schriebe, würde sich •mein Charakter wandeln, ich würde ein angenehmer, sympathischer Mensch, freundlich und ausgeglichener zu den Menschen, abgerundeter, vollkommener.
Alle zehn Jahre kaufe ich mir die Richtformen für die Schrift, wie sie die Volksschüler haben, und beginne ernsthaft danach meine Schrift zu reformieren. Nach meiner Erfahrung kommt es beim Schreiben auf zwei Dinge an: erstens sich Zeit zu lassen und zweitens die Feder fest in der Hand halten. Ich fange wieder zu schreiben an, wie die Kinder (ist das vielleicht die ' Entsprechung dafür, daß wir uns in jedem neuen Lebensalter danach sehnen, wieder wie die Kinder zu werden, wie es Jesus verlangt?). Gewiß, ich halte nicht durch, ich komme wieder ins alte Schmieren, aber etwas bleibt doch hängen, ganz umsonst ist kein Versuch, aus dem alten Geleise herauszukommen. Die Sehnsucht aber nach dem Schönschreiben erlischt nie in meinem Herzen.
Also hängt das alles zusammen: die Stahlfeder und das Verlangen nach dem Guten und Schönen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!