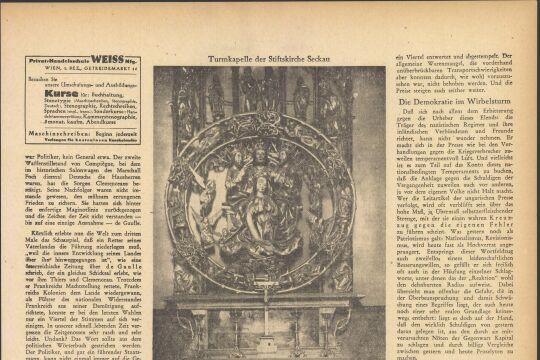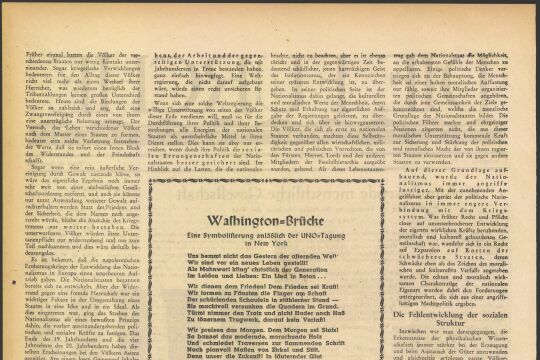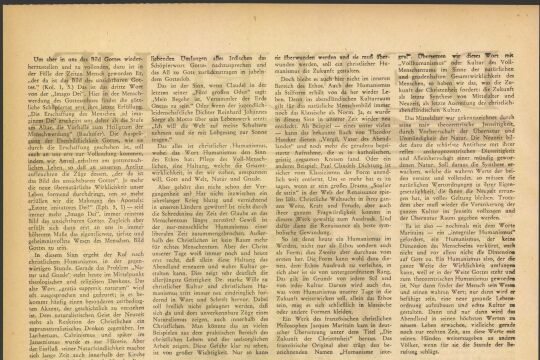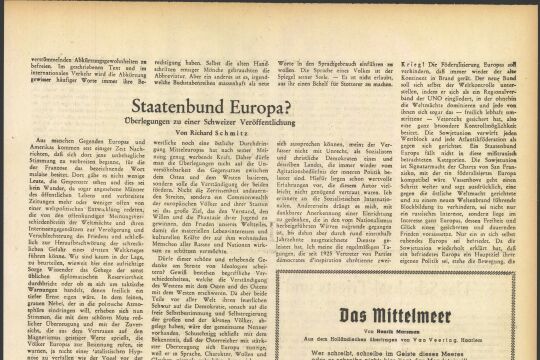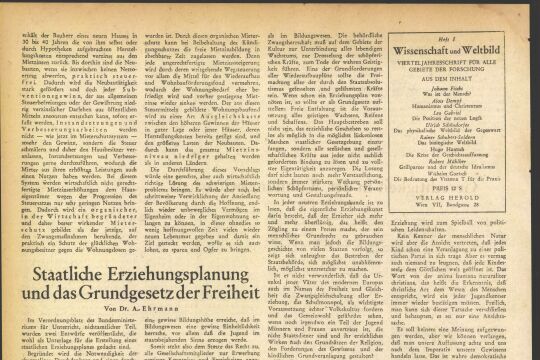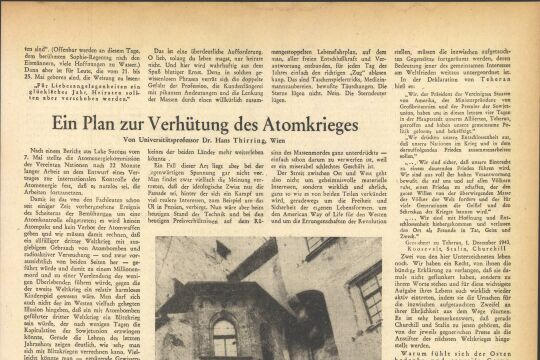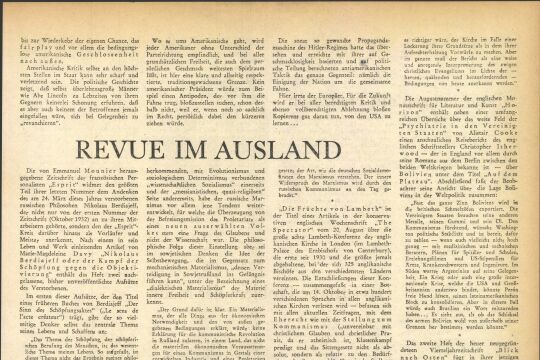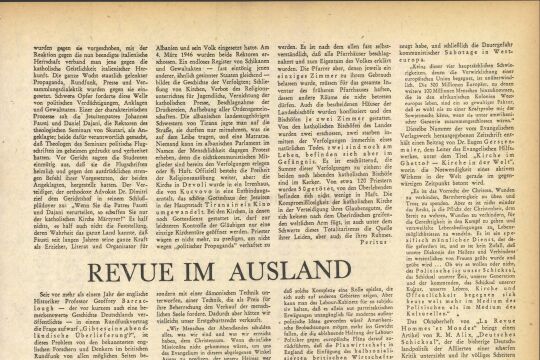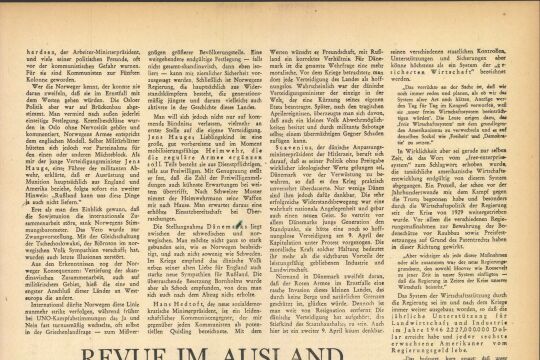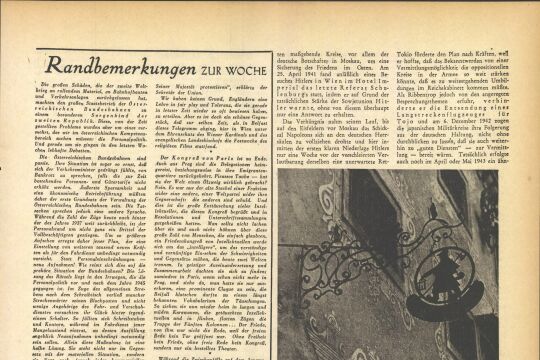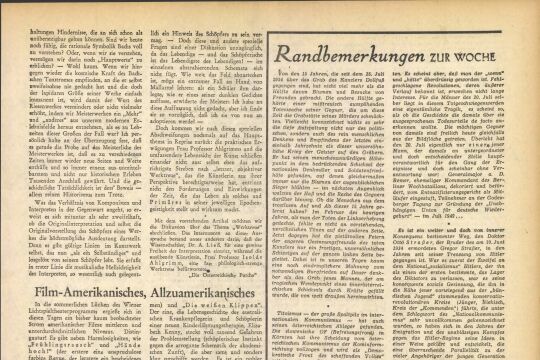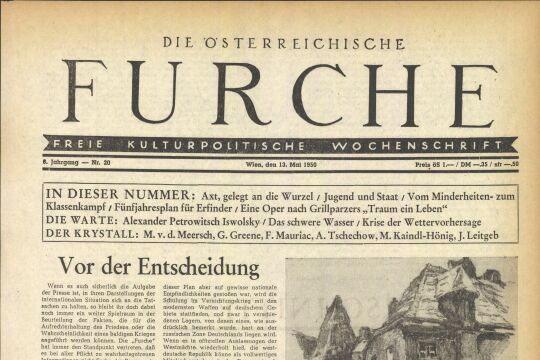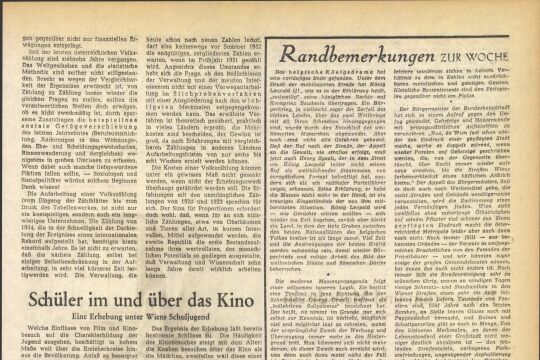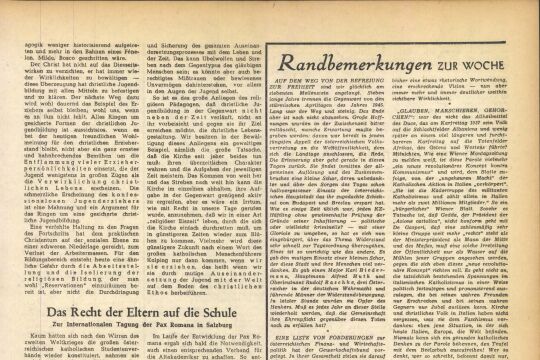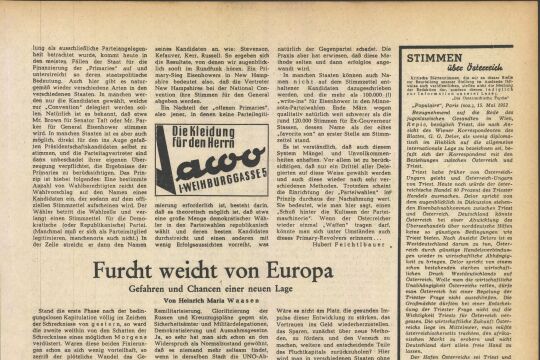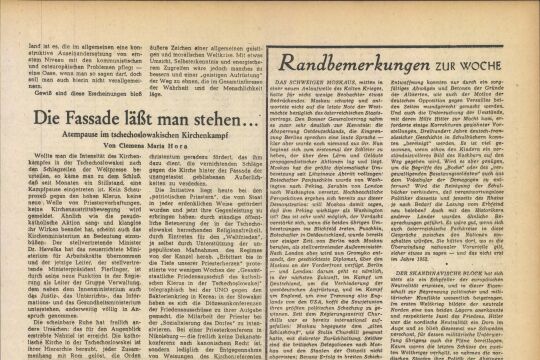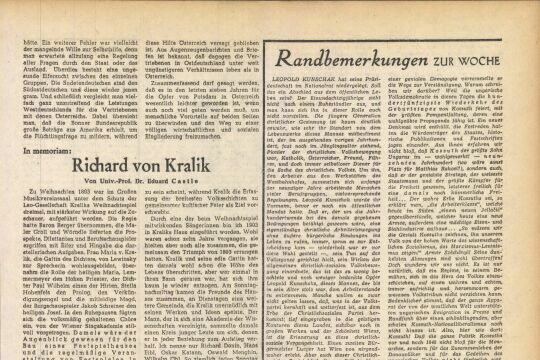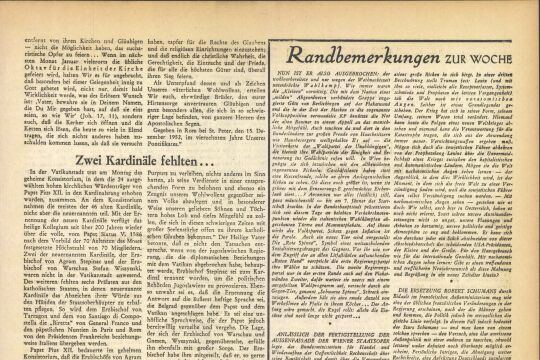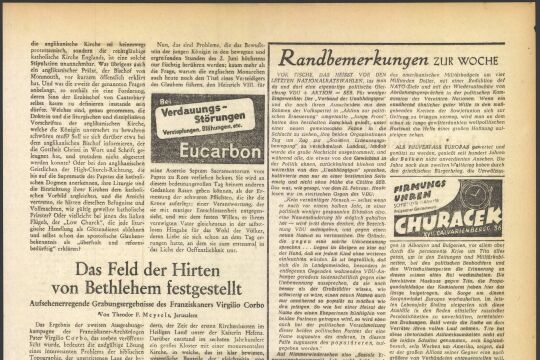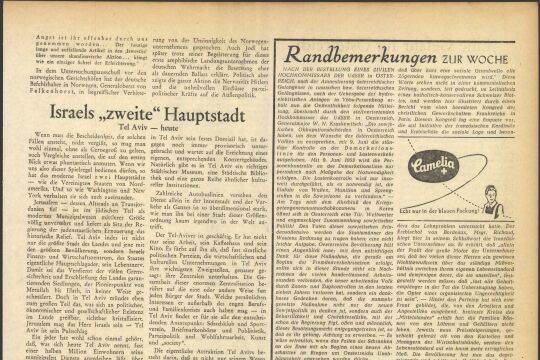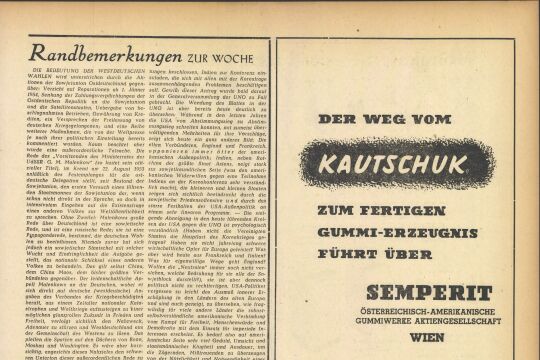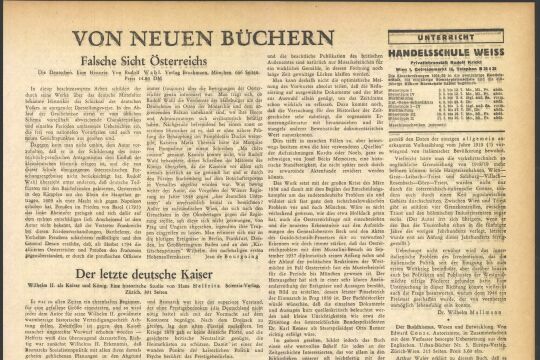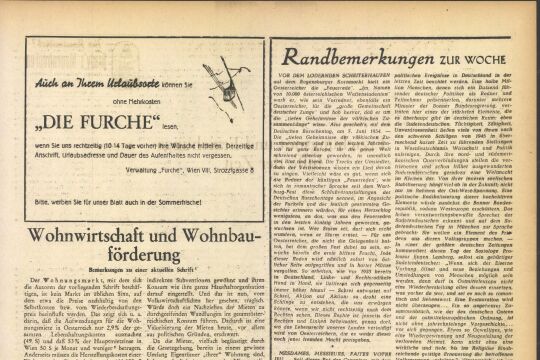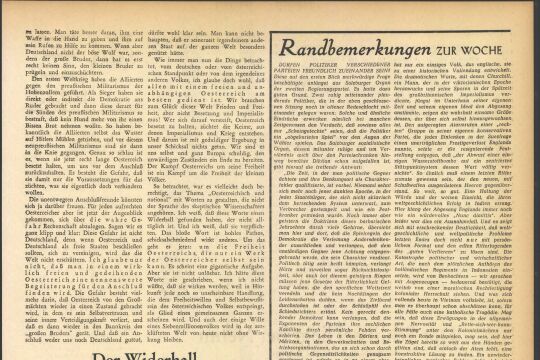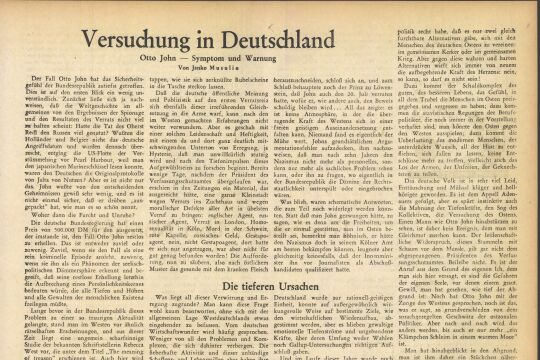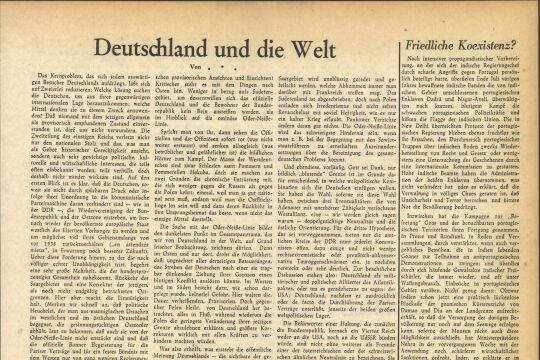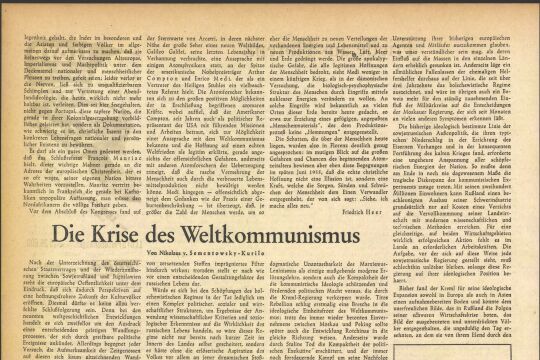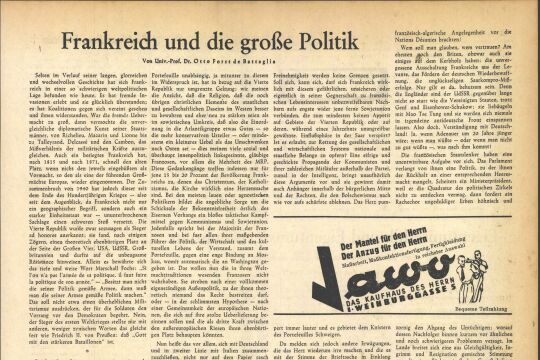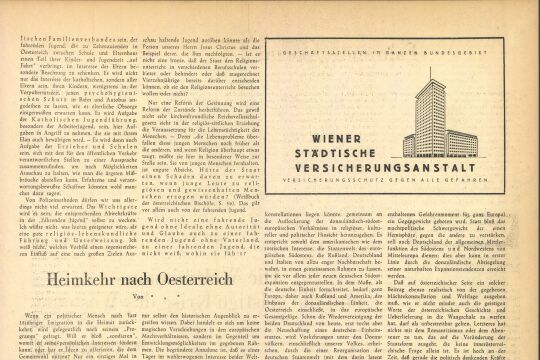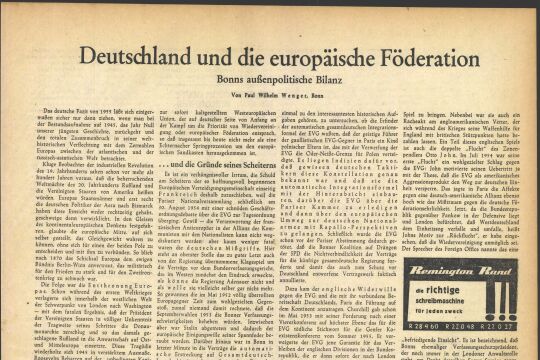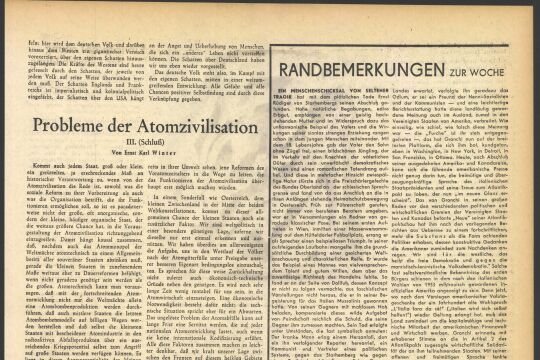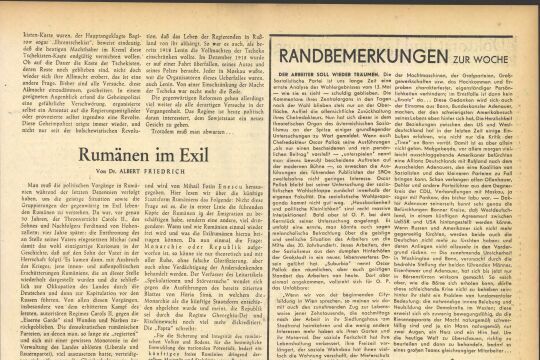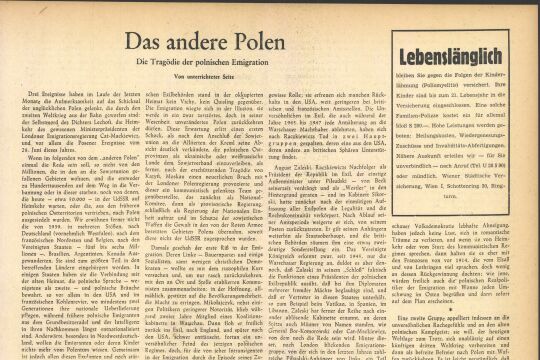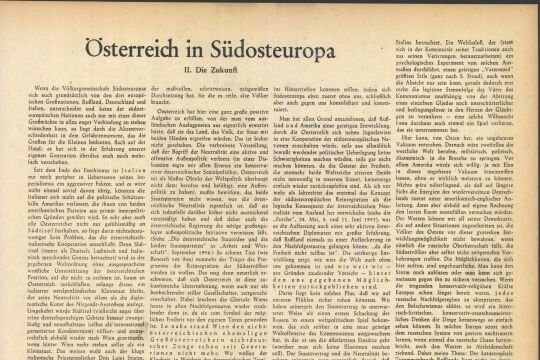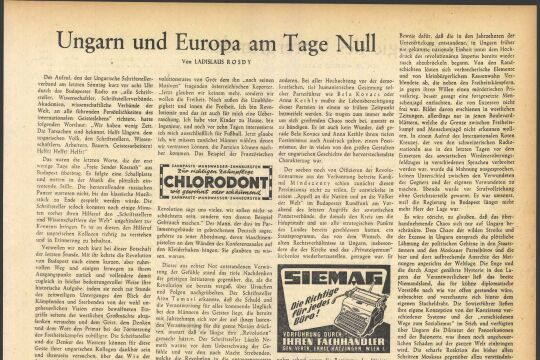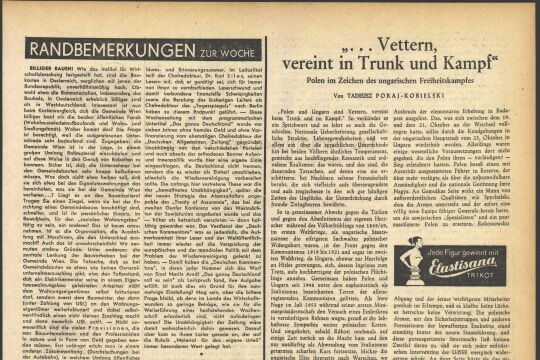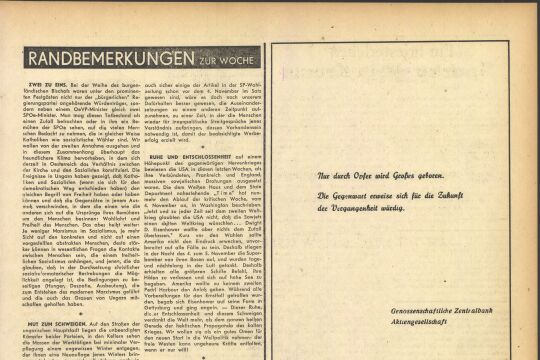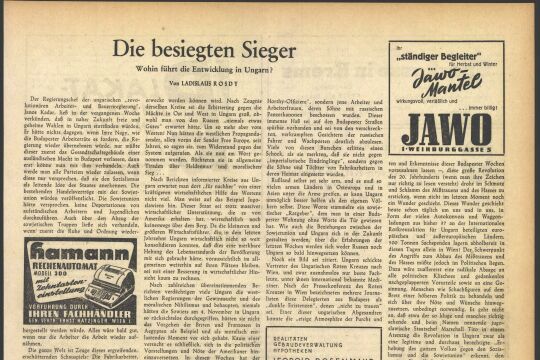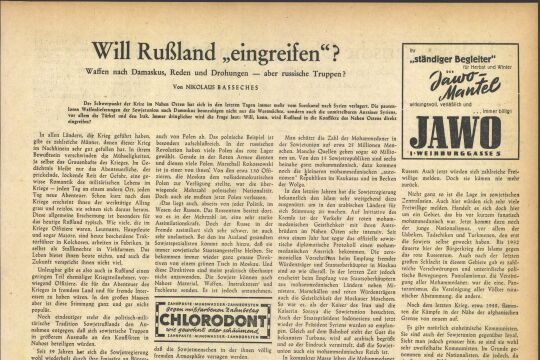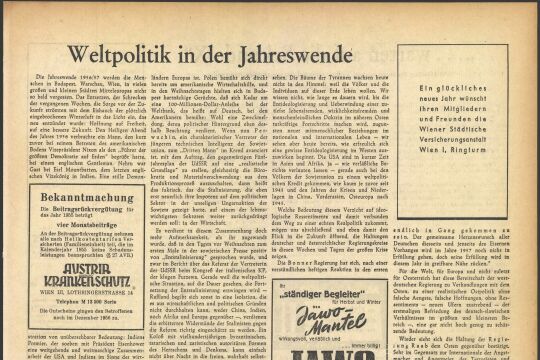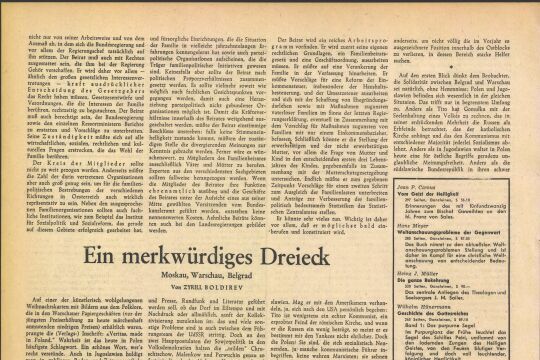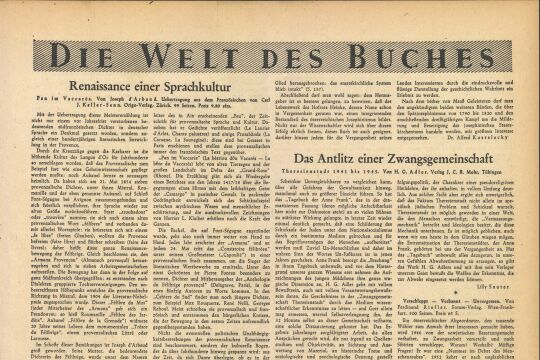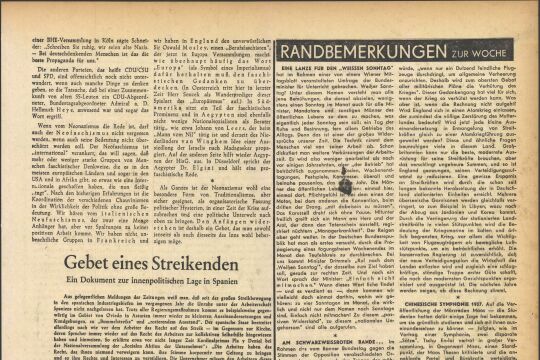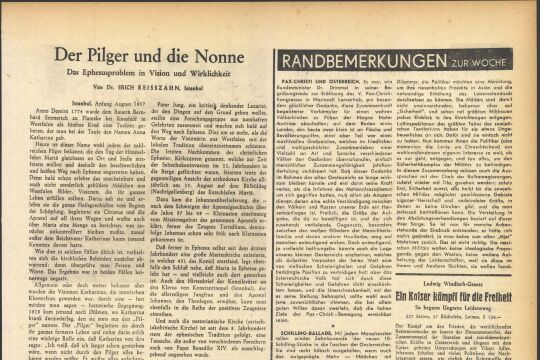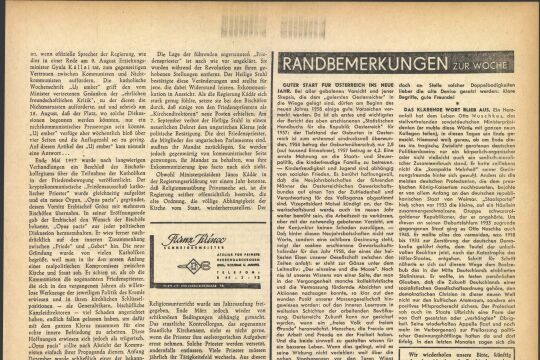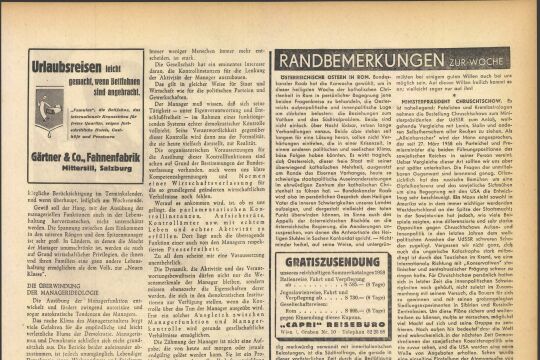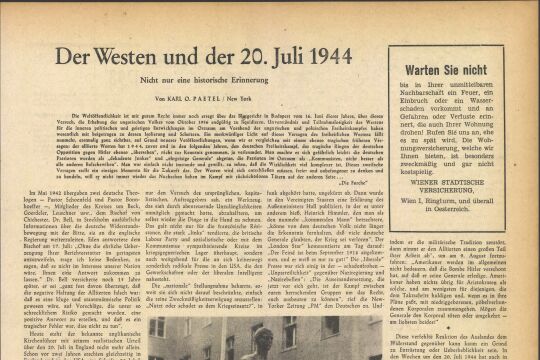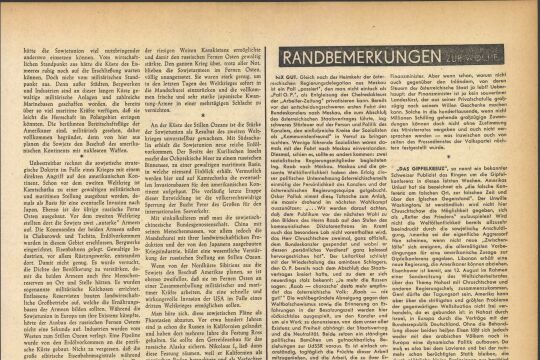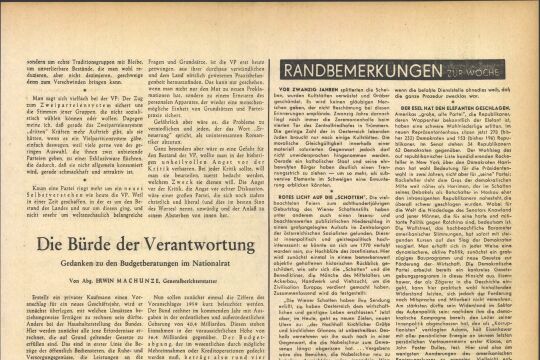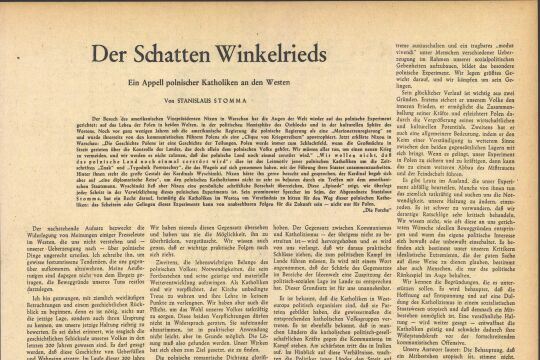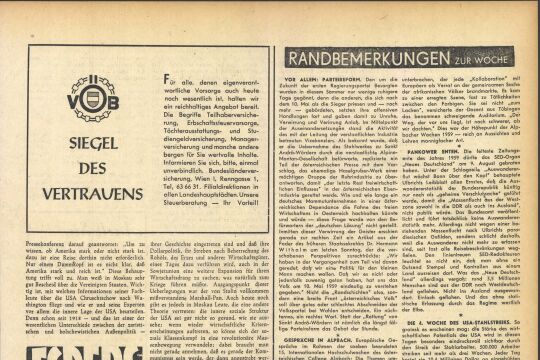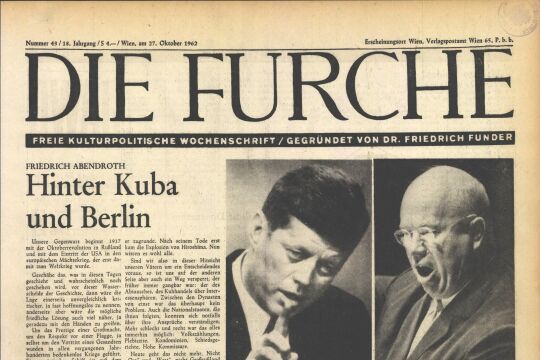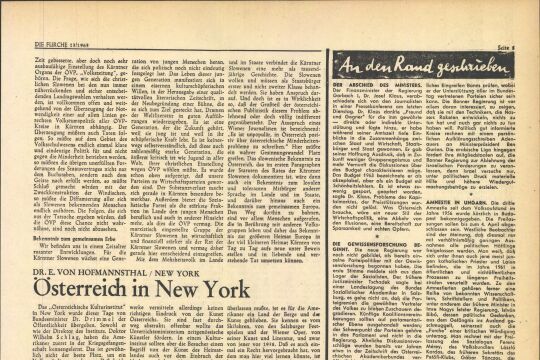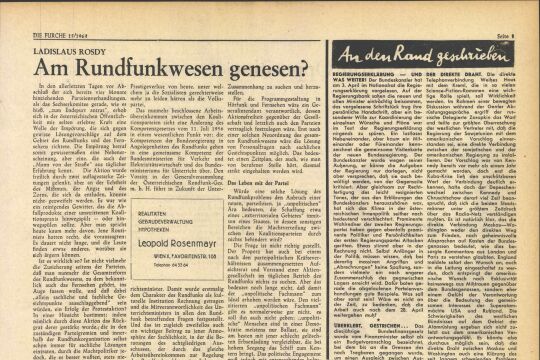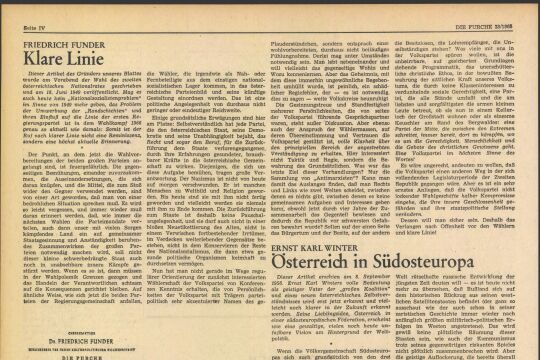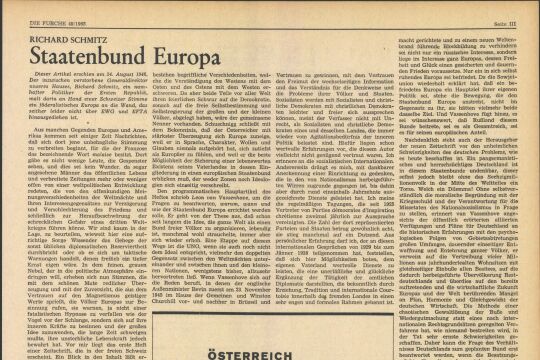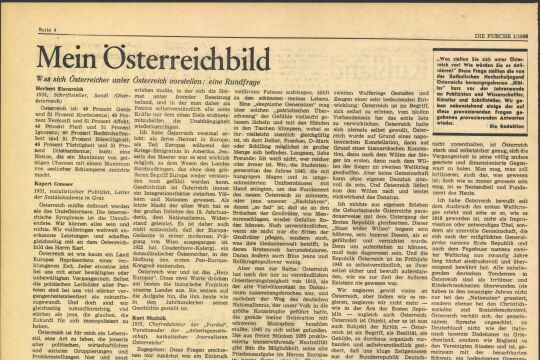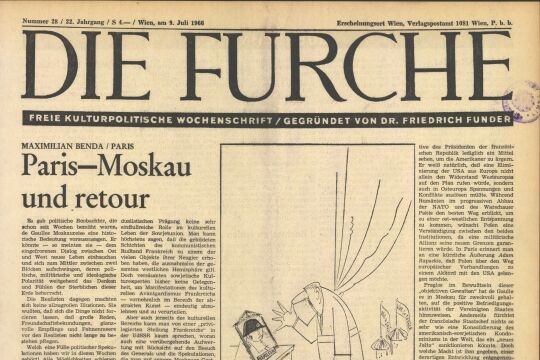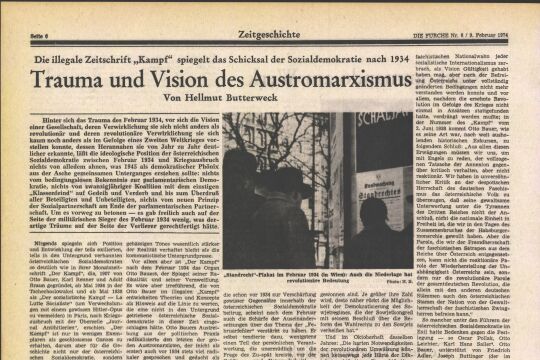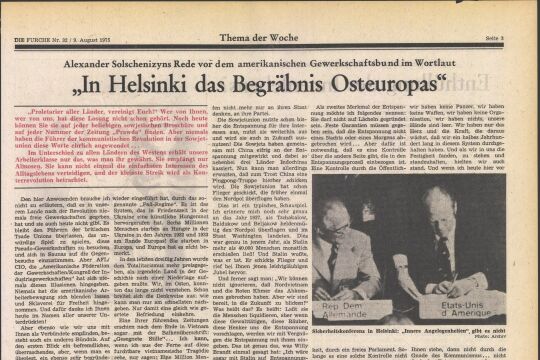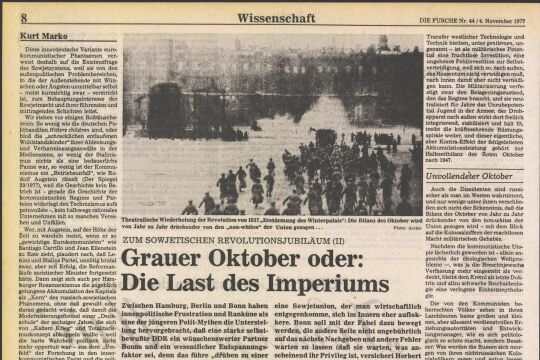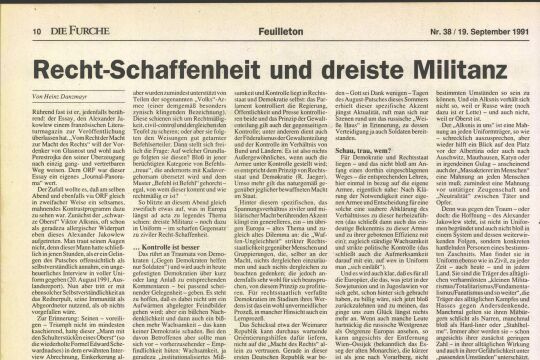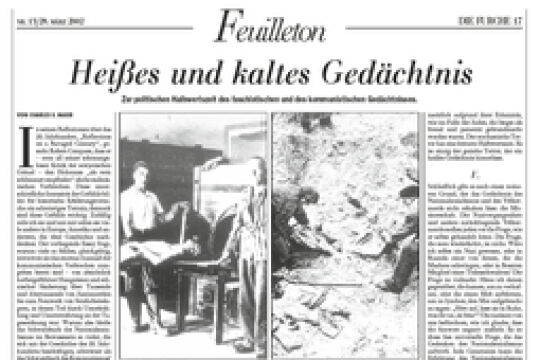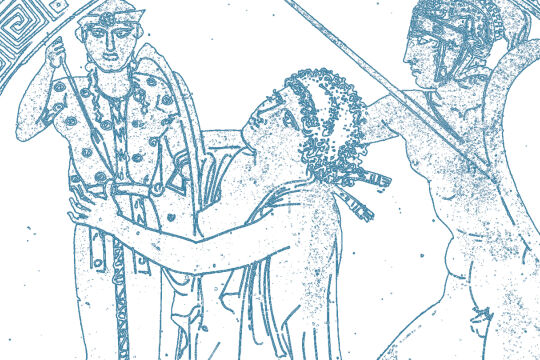Krieg & Frieden
DISKURS
Russland und Ukraine: Kriege der Erinnerung
Wladimir Putin hat den Ukraine-Krieg durch eine perfide Täter-Opfer-Umkehr legitimiert. Wie lässt sich die russische Aggression aus psychoanalytischer Sicht verstehen?
Wladimir Putin hat den Ukraine-Krieg durch eine perfide Täter-Opfer-Umkehr legitimiert. Wie lässt sich die russische Aggression aus psychoanalytischer Sicht verstehen?
Empörung, Schrecken und vor allem mit Hilflosigkeit: Das sind meist die Reaktionen auf die schrecklichen Nachrichten aus der Ukraine. Zusätzlich zu dem Wenigen, das wir an Solidarität leisten können durch Spenden und Aktivitäten, kann man zumindest versuchen, über die so entsetzlichen Vorgänge auch psychoanalytisch nachzudenken – und speziell über die Erzählung Putins, die diese Invasion legitimieren soll. Zuletzt sind viele Historiker bezüglich solcher Legitimierungsversuche zu ähnlichen Einschätzungen gekommen wie die Psychoanalytiker. Nicht zufällig hat Alexander Mitscherlich 1977 die Psychoanalyse „eine Geschichtswissenschaft“ genannt.
Gruppe im gemeinsamen „Zelt“
Der Psychoanalytiker Vamik Volkan ist schon durch seine Herkunft prädestiniert für die Problematik verfeindeter Gruppen: 1932 im türkischen Teil der später geteilten Insel Zypern geboren, studierte er Medizin in der Türkei, ging aber schon in jungen Jahren in die USA. Dort wurde er bekannt als Spezialist für schwere Persönlichkeitsstörungen und Psychosen. Parallel dazu beschäftigte er sich meist im Auftrag der UNO als Vermittler und Friedensstifter zwischen verfeindeten Nationen bzw. deren Gruppen. Er wurde viermal für den Friedensnobelpreis nominiert, war u. a. im Kosovo, in Palästina oder in Russland tätig. In oft jahrelanger Arbeit versuchte er, einen Dialog zwischen verfeindeten Großgruppen zu ermöglichen. Entscheidend für die Erfolgschancen sieht er die Frage, was die Identitätsphantasien im Konflikt für das jeweils andere Kollektiv bedeuten: Dadurch könne man ergründen, welche Emotionen und Ereignisse kollektive Identität festigen oder aber gefährden. Immer geht es darum, wie diese Gruppen ihre Identität bewahren und schützen können.
In seinen Schriften berichtet Volkan seit einem Vierteljahrhundert von seiner Friedensarbeit: Er entwickelte die Konzepte des „Zeltes“ als Symbol für die Identität einer Großgruppe und des „ausgewählten Traumas“ bzw. des „ausgewählten Triumphs“ als Bausteine nationaler Identitäten. In seinem Bild steht der Führer einer Großgruppe in der Mitte als Pfosten, der das Zelt aufrecht hält. Ebenso wichtig aber sind jene Bilder (entsprechend den National-Legenden oder Mythen), die an der Innenwand des Zeltes zu sehen sind und Gemeinsamkeit stiften für die „Bewohner“ dieses Großgruppen-Zeltes. Ähnlich beschreibt auch der Soziologe und ausgebildete Gruppenanalytiker Norbert Elias die „Wir-Schicht“ der individuellen Identität: Sie ist so wichtig wie unsere Kleidung, die uns schützt und wärmt.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!